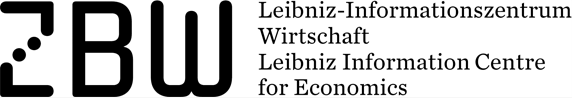„Der Wandel hin zu robusterer Forschung ist vor allem ein sozialer Wandel“
Eike Mark Rinke über seine Open-Science-Erfahrungen

Foto: University of Leeds
Die drei wesentlichen Learnings:
- Die Überschneidung von „guter“ und „erfolgreicher“ Forschungspraxis wird dank Open Science immer größer! Wer diese Praktiken beherrscht, verbessert seine Chancen auf Karrierefortschritte erheblich.
- Die „Basistransparenz“ von Forschungsergebnissen inkl. Daten und Codes ist essenziell und wird zunehmend erwartet. Darauf aufbauend kann man weitergehende Praktiken umsetzen: Präregistrierungen, Registered Reports oder sogar interaktive Tools (z.B. Shiny Apps), die nicht nur die Qualität und Zugänglichkeit der Forschung verbessern, sondern auch ein Alleinstellungsmerkmal und Karrierebooster sein können.
- Open Science ist ein sozialer Wandel und verbreitet sich vor allem über Communities und Netzwerke. Netzwerke bieten Austausch, soziale Anerkennung, soziale Energie und Zugang zu Expertise – und sind daher zentrale Treiber für den kulturellen Wandel in der Wissenschaft.
Wenn Sie auf Ihre Anfänge im Engagement für Open Science zurückblicken: Was war der Auslöser?
EMR: Einen einzelnen Moment gab es nicht. Mein Interesse entwickelte sich während meiner Promotions- und Postdoc-Phase, vor allem über Metaforschung. Ein früher Impuls war ein Preprint, in dem wir vor etwa zehn Jahren zeigten, dass viele Kommunikationswissenschaftler:innen grundlegende statistische Kennzahlen wie p-Wert oder Konfidenzintervall nicht korrekt definieren konnten – selbst wenn sie diese regelmäßig nutzten. Diese Erkenntnis war ein Schlüsselerlebnis, nahezu ein Schockmoment: Mir wurde klar, wie sehr die tatsächliche Forschungspraxis von den methodischen Standards in Lehrbüchern abwich. Hinzu kam das sogenannte Hidden Curriculum – informelle Regeln, die Senior Researchers an ihre Doktorand:innen weitergaben und die oft im Widerspruch zu guter wissenschaftlicher Praxis standen. Dazu gehörte etwa, möglichst viele abhängige Variablen zu erheben, um selektiv „funktionierende“ Ergebnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Damals galt das als normal. Heute ist klar, dass solche Praktiken systematisch zu wenig belastbarer Forschung führen. Das Bewusstsein dafür war für mich eine wesentliche Motivation, mich für robustere Wissenschaft und damit für Open Science einzusetzen.
Hat sich das in den vergangenen zehn Jahren verändert? Wird der Einfluss des Hidden Curriculum auf junge Forschende geringer?
EMR: Ja, das denke ich. Es ist ein schrittweiser Prozess, aber es gibt Fortschritte. Zum einen haben Metastudien und Preprints, die Defizite in der Forschungspraxis aufzeigen, einen aufklärenden Effekt. Vor allem aber hat die Open-Science-Bewegung eine starke normative Wirkung entfaltet: Sie stellt dem bisherigen, informellen Hidden Curriculum ein alternatives, stärker idealorientiertes Curriculum gegenüber. Immer mehr junge Forschende erkennen, dass diese Praxis nicht nur wissenschaftlich sinnvoll, sondern auch karriereförderlich sein kann. Zudem haben Debatten über p-Werte, Publikationsbias und ähnliche Themen einen bildenden Einfluss. Solche Diskussionen waren zu meiner Zeit als Nachwuchsforscher seltener; heute sind sie weit verbreitet. Insgesamt sehe ich deshalb deutliche Fortschritte.
Was ist bereits geschehen, und was muss noch passieren, damit Open Science zum Mainstream wird? Wo sehen Sie Fortschritte, wo strukturelle Hürden?
EMR: Entscheidend ist, das Wissenschaftssystem so zu gestalten, dass es Transparenz und Inklusion systematisch fördert. Hilfreich sind Strategien wie jene des Center for Open Science, die auf kulturellen Wandel zielen. Dennoch bestehen wesentliche strukturelle Hürden. Das Publish-or-Perish-Paradigma privilegiert weiterhin schnelle Publikationen und Zitationszahlen gegenüber sorgfältiger Wahrheitsfindung – also etwas, was man auch „Fast Science“ nennen könnte. In einem Wissenschaftssystem, in dem einzelne Forschende wie auch Institutionen im Wettbewerb um Reputation stehen, gilt Open Science daher oft als riskant. Hinzu kommt ein Status-quo-Bias: Die einflussreichsten Akteure, meist etablierte Senior Researchers, haben häufig am meisten zu verlieren. Ihr wissenschaftliches Renommee und viele ihrer Erfolge, ihr Lebenswerk sozusagen, basieren auf Praktiken, die in einer stärker offenen Wissenschaftskultur zumindest kritisch hinterfragt würden. Solange sich diese Anreizstrukturen nicht ändern, bleibt der Übergang zu Open Science ein langsamer, inkrementeller Prozess.
Ja, das ist in der Tat ein Thema, das alle betrifft, die mit Senior Researchers zusammenarbeiten. Deren Verhalten muss kritisch reflektiert werden, was jedoch häufig vermieden wird.
EMR: Genau. Und es geht dabei nicht nur um Selbstschutzinteressen. Viele Senior Researchers verfügen schlicht über wenig Zeit, sich intensiv mit neuen Entwicklungen wie Open Science zu befassen. Aufgrund ihrer umfangreichen Verpflichtungen in Lehre, Administration und Begutachtung sind sie häufig weniger über aktuelle Open-Science-Diskurse informiert.
Ist das tatsächlich eine Frage der Zeit? Junge Nachwuchsforschende stehen doch ebenfalls unter enormem Druck. Viele arbeiten mit befristeten Teilzeitverträgen, müssen ihren Lebensunterhalt sichern und gleichzeitig viel publizieren. Könnte man nicht eher argumentieren, dass Senior Researchers, die bereits etabliert sind, eher die zeitlichen Ressourcen hätten?
EMR: Das ist ein berechtigter Einwand, und ich gebe zu, dass ich hier möglicherweise zu wohlwollend argumentiere. Tatsächlich zeigen auch Metastudien zur Wissenschaftsproduktion, dass Innovationen überwiegend von jüngeren Forschenden ausgehen. Sie stehen unter größerem Druck, sich zu profilieren und an der Spitze der aktuellen Entwicklungen zu bleiben. Viele Open-Science-Praktiken sind eng mit diesen Entwicklungen verknüpft, weshalb sie vor allem von der jüngeren Generation vorangetrieben werden. Wer in führenden Methodenjournalen der Sozialwissenschaften publizieren möchte, kommt an Open Science kaum vorbei. Etablierte Forschende, die ihre Position bereits gesichert haben, verspüren diesen Anreiz oft weniger stark.
Welche Rolle spielt in Ihren Augen institutionelle Unterstützung auf dem Weg zu mehr Open Science, insbesondere durch Netzwerke wie das UK Reproducibility Network, in dem Sie selbst aktiv sind?
EMR: Diese Netzwerke sind aus meiner Sicht zentral. Der Wandel hin zu robusterer Forschung ist vor allem ein sozialer Wandel. Transdisziplinäre Communities, die sich Open Science und guter wissenschaftlicher Praxis widmen, wie man vielleicht altmodisch sagen würde, schaffen dafür die notwendige Grundlage. Man darf nicht vergessen: Die Nachwuchsforschenden von heute sind die Senior Researchers von morgen. Häufig wird in diesem Zusammenhang das „Plancksche Prinzip“ zitiert: Science progresses one funeral at a time. Das mag zugespitzt sein, trifft aber den Kern: Kultureller Wandel vollzieht sich über Generationen. Netzwerke bieten jungen Forschenden eine soziale Heimat und stärken ihren Idealismus, indem sie Austausch, Anerkennung und Zusammenarbeit ermöglichen. Gerade diese soziale Energie ist entscheidend. Thinking about exciting stuff together. Das ist auch ein großer Teil unseres UK Reproducibility Networks. Sie schafft Bindung, motiviert zur praktischen Umsetzung von Open Science und trägt langfristig dazu bei, dass offene Praktiken weniger als Sonderfall wahrgenommen und exotisiert und zunehmend zum Standard werden.
Sie sind Local Network Lead des UK Reproducibility Network an der Universität Leeds. Was genau umfasst diese Rolle?
EMR: Im Kern geht es um Community Building und Community Management. Meine Aufgabe ist es, Räume für Austausch zu schaffen und möglichst viele Kolleg:innen auf dem Campus dafür zu gewinnen und langfristig einzubinden. Konkret bedeutet das: Ich halte Vorträge für unterschiedliche Disziplinen, organisiere fachübergreifende Journal Clubs wie den ReproducibiliTea und arbeite eng mit unserer Universitätsbibliothek zusammen. Die Kolleg:innen dort sind, wenn man so will, „hidden heroes“ der Open-Science-Bewegung – sie leisten enorm viel für deren Förderung. Wir kooperieren bei Veranstaltungen, Podcasts und Informationsangeboten. Zudem fungiere ich als Ansprechpartner für die Universitätsleitung. Immer häufiger gibt es Anfragen, wie Open Science institutionell besser verankert werden kann. Kürzlich war ich beispielsweise Mitglied einer Task Force, die lokale Open-Research-Ressourcen für Forschende erarbeitet hat. Insgesamt verstehe ich meine Rolle als die eines lokalen Experten, der Wissen aus der Meta- und Open-Science-Forschung in den Campusalltag einbringt.
Sie sprechen vom Schaffen von Kommunikationsräumen. Das ist ja auch mein Arbeitsfeld: Menschen zusammenzubringen, Austausch zu ermöglichen, eine Art Facilitator zu sein. Was sind aus Ihrer Sicht die wirksamsten Maßnahmen? Was würden Sie anderen empfehlen?
EMR: Aus meiner Erfahrung sind zwei Punkte besonders wichtig. Erstens: Persönliche Relevanz für das jeweilige Publikum herstellen. Open Science hat seine Wurzeln zwar stark in der Psychologie und der dortigen Replikationskrise, aber die Diskussion muss immer in den Kontext der jeweiligen Disziplin übersetzt werden. Man sollte zuhören, empathisch sein und verstehen, welche Fragen und Herausforderungen die Forschenden in ihrem Fach haben, und dann zeigen, wie offene Wissenschaft konkret helfen kann.
Zweitens: Dort hingehen, wo Leute sozusagen eine „Captive Audience“ sind. In der Open-Science-Community gibt es ein ausgeprägtes „preaching to the choir“-Problem. Man muss dorthin gehen, wo Open Science normalerweise nicht auf der Agenda steht – etwa in institutsweite Veranstaltungen, Fakultätsmeetings oder Fortbildungen – und dort kurze, prägnante Impulse geben, kleine TED Talks. Ein Publikum, das nicht gezielt zu einer Open-Science-Veranstaltung gekommen ist, ist oft besonders wertvoll.
Drittens – und das ist langfristig vielleicht am wirkungsvollsten: früh ansetzen. Ich beziehe mich da gern auf die sogenannte „Impressionable Years Hypothesis“ aus der politischen Sozialisationsforschung, die besagt, dass sich Einstellungen vor allem in jungen Jahren verfestigen. Übertragen auf die Wissenschaft heißt das: Wer junge Forschende möglichst früh erreicht, beeinflusst ihre spätere Praxis nachhaltig.
Deshalb biete ich an meinem Fachbereich in Politikwissenschaft jedes Jahr ein Einführungsseminar für neue Doktorand:innen an. Dort vermittle ich nicht nur die Grundprinzipien von Open Science, sondern betone auch die strategische Dimension für die eigene Karriere in der Wissenschaft: Transparenz- und Reproduzierbarkeitsstandards sind längst Voraussetzung, um in vielen Fächern zu reüssieren. Man muss Daten veröffentlichen können. Man muss seinen Code veröffentlichen, gut kommentieren, dafür sorgen, dass die Befunde, die man berichtet, reproduzierbar sind. Und wer wirklich an der Spitze mitspielen möchte, sollte noch weiter gehen: Beispielsweise können Shiny Apps veröffentlicht werden, die eine interaktive Reanalyse der eigenen Daten in einem Browserfenster für die allgemeine Öffentlichkeit ermöglichen. Solche Praktiken können heute starke Karrierebooster sein. Wer sie beherrscht und einsetzt, erhöht seine Chancen erheblich, sich in dem kompetitiven Umfeld der Wissenschaft zu behaupten.
Sie bieten also Seminare für Studierende und Nachwuchsforschende an. Ist die Teilnahme für die Studierenden verpflichtend oder freiwillig? Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Impulse langfristig nachwirken? Gibt es konkrete Anhaltspunkte oder Indikatoren, die darauf hindeuten, dass die Inhalte Ihres Seminars tatsächlich in der wissenschaftlichen Praxis aufgegriffen werden?
EMR: Um mit der ersten Frage zu beginnen: Ja, die Teilnahme ist verpflichtend, weil das Seminar Teil der allgemeinen Einführungsveranstaltungen für neue Doktorand:innen ist. Es ist allerdings ein eigenständiges Modul innerhalb dieser Reihe, die von unterschiedlichen Lehrenden gestaltet und mit dem Leiter unserer Promotionsstudiengänge abgestimmt wird Zur Wirkung: Die Resonanz ist durchweg positiv. Viele Junior-Kolleg:innen sind dankbar, darauf vorbereitet zu werden, dass Ideal und Realität wissenschaftlicher Praxis häufig auseinanderklaffen – und dass es eine wachsende Community gibt, die daran arbeitet, diese Kluft zu verringern. Sie bekommen konkrete Werkzeuge an die Hand, mit denen sie selbst zu robusteren Praktiken beitragen können. Ich erhalte immer wieder informelle Rückmeldungen, die zeigen, dass das Seminar geschätzt wird.
Darüber hinaus erheben wir hier in Leeds regelmäßig Daten: Wir haben bereits zweimal fakultätsübergreifende Community Surveys durchgeführt, um Einstellungen, Wissen und Praktiken zu Open Science zu erfassen. Besonders erfreulich ist, dass die Universität derzeit daran arbeitet, Open-Science-Indikatoren systematisch zu erfassen. Das ist wirklich toll. Künftig sollen Forschende beim Melden neuer Publikationen angeben, ob Daten veröffentlicht wurden, ob der Code verfügbar ist und ob eine Präregistrierung vorliegt – jeweils mit Verweis auf die entsprechenden Quellen. Auf diese Weise entsteht eine institutionelle Datenbank, die langfristig wertvolle Einblicke gibt und es ermöglicht, Maßnahmen gezielt zu steuern.
Sie sind nicht nur in Leeds aktiv, sondern kennen auch andere Open-Science-Communities. Gibt es aus Ihrer Sicht internationale Vorreiter? Würden Sie sagen, dass etwa das Vereinigte Königreich besonders weit ist, die Niederlande oder vielleicht bestimmte US-Institutionen? Beobachten Sie internationale Unterschiede?
EMR: Ja, eindeutig. Großbritannien ist durch das UK Reproducibility Network sehr gut aufgestellt, ebenso die Niederlande. Auch in den USA sind Open-Science-Praktiken an vielen Top-Institutionen fest etabliert. Deutschland hat in den vergangenen Jahren ebenfalls deutlich aufgeholt. Allerdings würde ich weniger von Länderunterschieden sprechen, sondern eher von Unterschieden zwischen forschungsintensiven und weniger forschungsintensiven Institutionen. Viel hängt mit dem Qualitätsanspruch der jeweiligen Einrichtungen, ihren Ressourcen für Training und methodische Weiterbildung sowie dem Selbstverständnis der Forschenden zusammen.
Das heißt, die Top-Institutionen sind beim Thema Open Science deutlich aktiver. Das wäre ja auch ein starkes Argument: Wer in der „ersten Liga“ mitspielen will, sollte Open Science umsetzen – es stärkt die Reputation.
EMR: Absolut. Und es gibt sogar ein noch konkreteres Argument, das ich regelmäßig in meinen Einführungsveranstaltungen für neue Doktorand:innen anbringe. Auch wenn man viel Kritik an Impact-Faktoren üben kann – sie sind nach wie vor ein wichtiger Indikator für das Standing von Journals. Wenn man analysiert, wie sich Journals in der Politikwissenschaft hinsichtlich ihrer Open-Science-Anforderungen unterscheiden, zeigt sich ein klares Muster: In den beiden unteren Quartilen gibt es so gut wie keine Vorgaben. Im zweiten und dritten Quartil sind die Anforderungen in den vergangenen zehn Jahren leicht gestiegen. Und in den Top-Journals – also dem obersten Quartil – ist der Anteil an Open-Science-Anforderungen regelrecht explodiert. Mit anderen Worten: Wer heute in den führenden Journals publizieren will, kommt an Open Science nicht vorbei.
Ein Beispiel: Ich bin Associate Editor bei Political Communication, einem sehr guten Journal meines kleinen Fachgebiets. Dort haben wir vor zwei Jahren die Position eines Data Editors eingeführt. Dieser überprüft systematisch, ob Daten offengelegt sind, ob der Code verfügbar ist und vor allem ob berichtete Befunde tatsächlich reproduzierbar sind. Stimmt etwas nicht – etwa weil der Code fehlerhaft ist oder die Ergebnisse nicht reproduzierbar sind – wird das Manuskript nicht veröffentlicht. Das ist eine klare Voraussetzung für die Publikation.
Die Open-Science-Agenda für die Kommunikationswissenschaft, über die ich hier im Magazin derzeit mit Tobias Dienlin gesprochen habe, enthält viele konkrete Vorschläge. Welche davon halten Sie aus Ihrer Erfahrung für besonders wirksam? Was würden Sie einem Junior Researcher raten, der oder die mit wenigen, aber effektiven Schritten beginnen möchte?
EMR: Das hängt natürlich stark davon ab, an wen man sich richtet. In der Agenda gibt es Maßnahmen, die sich vor allem an Institutionen, Forschungsförderer oder Journals richten – etwa unsere Empfehlung, die TOP Guidelines zu implementieren oder Anreize zur Annahme von Open-Science-Praktiken zu schaffen. Diese sind aus systemischer Perspektive besonders wichtig, betreffen aber weniger das individuelle Handeln. Wenn wir uns auf Nachwuchsforschende konzentrieren, ist der entscheidende erste Schritt, die Reproduzierbarkeit der eigenen Forschung sicherzustellen. Das klingt trivial, ist aber essenziell. Konkret bedeutet das: Materialien, Datensätze und Code sollten offen zugänglich gemacht werden – Open Data und Open Code sind die Basis. Ohne diese Grundtransparenz bleibt alles andere zweitrangig. Darauf aufbauend kann man weitere Schritte gehen: etwa Versionskontrolle und Projektorganisation über Plattformen wie GitHub, um die Nachvollziehbarkeit der eigenen Arbeit zu erhöhen. Danach bieten sich komplexere Praktiken wie Präregistrierungen oder sogar Registered Reports an. Aber der erste und wichtigste Schritt bleibt die Herstellung dieser grundlegenden Transparenz.
Viele Forschende haben nur begrenzte Zeitressourcen. Wenn Sie Open Science empfehlen – an welchem Punkt würden Sie raten, sich aktiv um Open Access zu kümmern?
EMR: Sobald das Projekt so weit ist, dass erste Ergebnisse öffentlich gemacht werden können – also etwa bei der Veröffentlichung eines Preprints, einer frühen Manuskriptversion oder spätestens bei einer Präregistrierung. Spätestens dann sollte man sicherstellen, dass man die Rechte an der eigenen Arbeit behält, also Copyright Retention gewährleistet ist. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Bibliothek hilfreich. Die meisten Forschenden haben wenig Interesse, sich intensiv mit urheberrechtlichen Fragen auseinanderzusetzen – oft aus einer eher kurzsichtigen Haltung heraus: „Hauptsache, ich habe die Publikation für meinen Lebenslauf; wer sie liest, ist zweitrangig.“ Diese Sichtweise blendet jedoch eine zentrale Dimension von Open Science aus. Open Science bedeutet nicht nur robuste und transparente, sondern auch inklusive und gesellschaftlich zugängliche Forschung. Open Access ist dafür essenziell: Forschung gewinnt gesellschaftlichen Wert in dem Maße, in dem sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das gilt ganz besonders für die Geistes- und Sozialwissenschaften, die weniger auf technische Innovationen sondern vielmehr auf die Stärkung unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses abzielen. Diesen Gedanken muss man immer wieder betonen. Gleichzeitig ist es realistisch, anzuerkennen, dass Universitäten und insbesondere Bibliotheken hier eine Schlüsselrolle spielen. Sie müssen einen Großteil der organisatorischen Arbeit übernehmen, um Open Access sicherzustellen, und gleichen damit aus, dass viele Forschende diesem Aspekt nach wie vor zu wenig Aufmerksamkeit widmen – selbst unter jenen, die sich ausdrücklich zur Open-Science-Bewegung bekennen.
Kommen wir zu Ihrer eigenen Forschung. Sie haben sich wissenschaftlich mit Präregistrierungen und Registered Reports beschäftigt. Welche konkreten Vorteile haben diese Verfahren? Was haben Sie herausgefunden – sowohl in Bezug auf die Qualität der eigenen Forschung als auch auf mögliche Effekte für die wissenschaftliche Karriere?
EMR: Präregistrierungen und Registered Reports sind ein zentrales Element der Open-Science-Innovationen, die zunehmend zum Standard werden. In bestimmten Forschungsfeldern – insbesondere in der experimentellen Laborforschung – ist Präregistrierung inzwischen faktisch unverzichtbar, wenn man in guten Journals publizieren möchte. In anderen Bereichen, etwa in Teilen der Sozialwissenschaften, ist sie zwar noch nicht normativ, verschafft aber bereits klare Vorteile – und zwar nicht nur im Hinblick auf Publikationschancen. Ein wesentlicher Punkt, den ich immer wieder betone, ist der Gewinn an Vertrauen in die eigenen Befunde. Präregistrierung ist nicht nur eine formale Anforderung, sondern auch ein Instrument der Selbstkontrolle. Man geht gewissermaßen einen Pakt mit sich selbst ein: Man legt im Vorfeld fest, welche Hypothesen und Analysen man durchführt, und reduziert damit das Risiko, sich – bewusst oder unbewusst – von nachträglichen Anpassungen oder selektiver Auswertung leiten zu lassen. Für viele Forschende bedeutet das ein erheblich stärkeres Vertrauen in die Belastbarkeit der eigenen Arbeit.
Sie haben an einer Open-Research-Fallstudie in der Politikwissenschaft gearbeitet. Inwiefern lassen sich die Ergebnisse auf die Wirtschaftsforschung übertragen?
EMR: Meiner Ansicht nach sind nahezu alle Aspekte dieser Fallstudie ebenso für die Wirtschaftsforschung relevant wie für die Politikwissenschaft. Das führt zu einem grundsätzlichen Punkt, der mir wichtig ist: Einerseits ist es sinnvoll, die Open-Science-Diskussion fachspezifisch zu führen und auf die jeweiligen Methoden, Datenarten und Forschungskulturen einzugehen. Andererseits sollten wir die transdisziplinäre Relevanz der Grundprinzipien nicht unterschätzen. Die zentralen Ziele von Open Science – Transparenz, soziale Zugänglichkeit, Robustheit – gelten über alle Disziplinen hinweg. Man sollte daher nicht der Versuchung erliegen, jede Beobachtung zu stark zu kontextualisieren oder gar zu relativieren. Aussagen wie „Das gilt nur für die Psychologie, aber nicht für uns“ oder „Was wir in der Politikwissenschaft gefunden haben, ist für die Wirtschaftswissenschaft nicht übertragbar“ greifen zu kurz. Die grundlegenden Lektionen ähneln sich in allen Feldern stark; Unterschiede liegen eher in den Akzenten – abhängig von Datentypen und Analysemethoden. Gerade Politikwissenschaft und Wirtschaftsforschung sind sich methodisch sehr nah. Für diese beiden Disziplinen sind die Befunde daher unmittelbar übertragbar.
Vielen Dank!
*Das Gespräch wurde geführt am 23. Juni 2025 von Dr. Doreen Siegfried.
Über Dr. Eike Mark Rinke:
Dr. Eike Mark Rinke ist Lecturer in Politics and Media an der University of Leeds und Co-Direktor des Centre for Democratic Politics. Er engagiert sich aktiv in der Open-Science-Bewegung, ist Local Network Lead des UK Reproducibility Network (UKRN) an der University of Leeds und Mitglied des BITSS Catalyst Programms zur Förderung von Transparenz und Reproduzierbarkeit in den Sozialwissenschaften. 2024 wurde sein Einsatz für offene Wissenschaftspraktiken mit dem Research Culture Award der University of Leeds ausgezeichnet.
In seiner Forschung hat sich Rinke auf die empirische und normative Untersuchung der politischen Kommunikation auf individueller und gesellschaftlicher Ebene spezialisiert. Dazu gehören Studien über die demokratische Qualität der Art und Weise, wie Journalist:innen und Bürger:innen über politische Ideen, Ereignisse und Personen in verschiedenen Kontexten kommunizieren, von Wahlkampagnen bis hin zu politischen Beteiligungsveranstaltungen und von sozialen Protesten bis hin zum Alltagsleben.
Kontakt: https://essl.leeds.ac.uk/politics/staff/1073/dr-eike-mark-rinke
Bluesky: https://bsky.app/profile/emrinke.bsky.social
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eike-mark-rinke-4a122210/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Eike-Mark-Rinke-2035219321