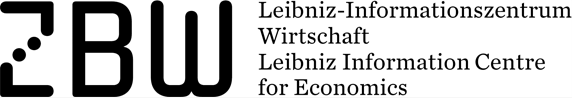Frühzeitige Open-Science-Praktiken erhöhen Forschungsqualität
Anna Popova über ihre Open-Science-Erfahrungen

Die drei wesentlichen Learnings:
- Die bewusste Auseinandersetzung mit Open Science zu Beginn der wissenschaftlichen Laufbahn hilft dabei, Studien sorgfältiger zu planen, methodische Schwächen zu vermeiden und selbst nicht-signifikante Ergebnisse fundiert zu verteidigen.
- Praktiken wie Präregistrierung, Open Data und Replikationsstudien erhöhen nicht nur die methodische Stringenz, sondern schützen insbesondere junge Forscher:innen vor Vorwürfen selektiver Bewertung oder unzureichender Forschung.
- Der Austausch mit Forschenden, die ähnliche Werte vertreten, erleichtert die Zusammenarbeit, schafft Vertrauen und unterstützt die Entwicklung gemeinsamer Forschungsziele.
Wie haben die Erfahrungen während Ihrer Masterarbeit, insbesondere der eingeschränkte Zugang zu Daten und Informationen, Ihre Einstellung zu den Prinzipien von Open Science geprägt?
AP: Ich bin während meines Masterstudiums bei der Arbeit an einer Metaanalyse für meine Abschlussarbeit zum ersten Mal mit den Prinzipien von Open Science in Berührung gekommen. Bei der intensiven Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur stellte ich überrascht fest, dass vielen Artikeln wesentliche Informationen fehlten und kein Zugang zu den Datensätzen gewährt wurde. Dies stellte meine Forschung vor erhebliche Hindernisse und warf wichtige Fragen hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit und Reproduzierbarkeit auf. Seitdem habe ich mich aktiv mit den Praktiken von Open Science beschäftigt und erkannt, wie wichtig sie für eine qualitativ hochwertige und unvoreingenommene Forschung sind.
Können Sie uns ein Beispiel für bewährte Verfahren aus Ihrem Bereich nennen?
AP: Ich halte Registered Reports für ein hervorragendes Beispiel für Open Science in der Praxis, und sie finden zunehmend Akzeptanz in verschiedenen Disziplinen. Ein Registered Report ist ein Artikel, der geschrieben und von einer Fachzeitschrift angenommen wird, bevor die Ergebnisse bekannt sind. Dieser Ansatz hilft, Publication Bias und selektive Berichterstattung zu vermeiden: Die Forscher:innen entwerfen die Studie, legen ihre Analysen im Voraus fest und tragen erst nach der Datenerhebung die tatsächlichen Ergebnisse ein.
Haben Sie konkrete Erfahrungen gemacht, die Sie überrascht haben?
AP: Ich arbeite derzeit an einer großen Metaanalyse, und eine Sache, die mich immer wieder überrascht, ist die Heterogenität der Berichtsstandards in den verschiedenen Fachzeitschriften. Viele Artikel – selbst solche, die in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht werden – geben Signifikanzschwellen an, lassen aber die tatsächlichen p-Werte weg.
Haben Ihnen Ihre Open-Science-Aktivitäten konkrete Vorteile gebracht?
AP: Ja, ich habe an Replication Games teilgenommen, bei denen ich einen politikwissenschaftlichen Artikel replizieren musste. Das war eine großartige Gelegenheit, ein Forschungsthema, das mich interessiert, aus der Perspektive eines anderen Fachgebiets zu erkunden.
Welche Vorteile sehen Sie für Doktorand:innen und junge Forschende, wenn sie sich früh in ihrer Karriere mit Open-Science-Praktiken beschäftigen?
AP: Es gibt viele Vorteile: In erster Linie produziert man qualitativ hochwertige Forschung. Durch die Präregistrierung des Projekts kann man sehr gründlich über das Design nachdenken und vermeidbare Probleme vermeiden. Auf diese Weise lassen sich auch unbedeutende Ergebnisse leichter verteidigen und veröffentlichen.
Wie reagieren Ihre Betreuer:innen oder Senior Scientists auf Ihr Engagement für Open Science und/oder Lab Square? Unterstützen sie es oder gibt es Skepsis?
AP: Mein Betreuer ist ein großer Befürworter von Open Science. Auch hier ist es (meiner Meinung nach) für ihn das Wichtigste, qualitativ hochwertige, reproduzierbare Forschungsergebnisse zu erzielen.
Welche Open-Science-Praktiken (z. B. Preprints, offene Daten, Replikationsstudien) halten Sie für besonders relevant in der Wirtschaftsforschung?
AP: Alle diese Praktiken sind für die Wirtschaftsforschung wichtig, aber meiner Meinung nach sind Replikationsstudien besonders relevant. Viele bedeutende Studien sind zu Grundlagen unseres Fachgebiets geworden und prägen unser Denken und unsere Forschungsarbeit. Als Doktorand:in kann es schwierig sein, diese wegweisenden Arbeiten in Frage zu stellen, selbst wenn man Widersprüche findet. Die Replikation älterer Studien und der Nachweis, dass einige grundlegende Ergebnisse möglicherweise nicht so robust sind wie bisher angenommen, sind unerlässlich, damit junge Wissenschaftler:innen die Wissenschaft vorantreiben können.
Wie beeinflusst Open Science Ihre Sicht auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Nachwuchsforschenden?
AP: Ich finde die Zusammenarbeit mit Menschen, die Open-Science-Praktiken unterstützen und sie als wertvoll erachten, definitiv vielversprechender. Für mich sind dies Grundwerte, die es ermöglichen, die Ziele eines Forschers oder einer Forscherin zu identifizieren, und ich freue mich sehr, dass viele junge Wissenschaftler:innen Open Science befürworten.
Sind Sie der Meinung, dass Open Science die Karriereentwicklung von Nachwuchsforschenden unterstützt oder birgt sie Risiken?
AP: Als Nachwuchswissenschaftler:in kann man die eigene Arbeit auf jeden Fall selbstbewusster verteidigen. Wie bereits erwähnt, gehören „überraschende” oder nicht-signifikante Ergebnisse zum normalen wissenschaftlichen Alltag. Wenn man zeigen kann, dass der Widerspruch zu einer wegweisenden Studie mit einer fehlgeschlagenen Replikation vereinbar ist oder dass die eigene Studie präregistriert und transparent durchgeführt wurde, stärkt dies die Glaubwürdigkeit und schützt vor dem Vorwurf, die Ergebnisse seien auf ein schlechtes Forschungsdesign oder Data Mining zurückzuführen.
Welche Initiativen würden Sie sich von akademischen Einrichtungen oder Förderorganisationen wünschen, um Open Science für Nachwuchswissenschaftler:innen attraktiver zu machen?
AP: Open Science sollte angemessen gefördert werden. Oft ist damit ein erheblicher Mehraufwand verbunden, der häufig unterschätzt wird. Zwar werden bestimmte Praktiken – wie die Präregistrierung – mittlerweile zum Standard, doch die Qualität der Umsetzung ist nach wie vor sehr unterschiedlich. So wird beispielsweise die Präregistrierung einer Studie mittlerweile erwartet, nicht jedoch die Erstellung einer klaren, informativen und gut strukturierten Präregistrierung. Das Gleiche gilt für gut dokumentierte Datenpakete. Um dem entgegenzuwirken, sollten wir bewährte Verfahren fördern, institutionelle Unterstützung bereitstellen und standardisierte Tools und Leitlinien entwickeln, um hochwertige Open Science einfacher und lohnender zu machen.
Haben Sie Tipps für Wissenschaftler:innen, die noch keine Erfahrung mit Open Science haben, worauf sie besonders achten sollten, wenn sie damit beginnen?
AP: Sie sollte geduldig sein. Viele Open-Science-Praktiken werden vom akademischen System noch nicht vollständig gefördert, aber sie sind die Mühe auf jeden Fall wert. Die Erstellung eines Voranalyseplans für mein experimentelles Projekt hat mir beispielsweise geholfen, mein Design gründlicher zu durchdenken. Das hat die Qualität der Studie erheblich verbessert und mir geholfen, größere Fehler zu vermeiden, die mir sonst vielleicht entgangen wären.
Inwiefern empfinden Sie die Arbeit mit Open Science als bereichernd für Wissenschaft und Forschung?
AP: Open Science hat mir geholfen, mich wieder mit meiner ursprünglichen Motivation für die Forschung zu verbinden. In einem Umfeld, in dem oft „publish or perish“ vorherrscht, verliert man leicht den Sinn der Wissenschaft aus den Augen. Ich habe meine Promotion aus echter Neugier und Interesse am Verständnis der Welt begonnen, und Open-Science-Praktiken haben mir geholfen, dies wiederzufinden. Selbst Ergebnisse, die statistisch nicht signifikant sind, können wertvoll sein – und Open Science ermutigt uns, dies anzuerkennen und zu teilen.
Wie schätzen Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen die zukünftige Bedeutung von Open Science ein?
AP: Angesichts der anhaltenden Replikationskrise glaube ich, dass Open Science in Zukunft eine immer zentralere Rolle in der Forschung spielen wird. Es wird bereits jetzt schwierig, experimentelle Arbeiten ohne Präregistrierung zu veröffentlichen, und immer mehr Forscher:innen beginnen, den Wert von Transparenz zu schätzen – nicht nur als Voraussetzung, sondern als Kernbestandteil einer rigorosen und aussagekräftigen Wissenschaft.
Wie könnten Ihrer Meinung nach mehr Wissenschaftler:innen von den Vorteilen von Open Science überzeugt werden?
AP: Ich habe noch niemanden getroffen, der nicht letztendlich vom Wert von Open Science überzeugt war. Ich verstehe zwar die Sorge, dass „Open Science die Kreativität zerstören könnte”, aber wenn ich mir die Zahl der fehlgeschlagenen Replikationen wegweisender Arbeiten anschaue, denke ich: Es ist in Ordnung, Kreativität einzuschränken, die einer gewissen methodischen Strenge nicht standhält. Es gibt bereits zahlreiche wissenschaftliche Belege und einen wachsenden Konsens darüber, dass Open-Science-Praktiken die Forschungsqualität verbessern und der wissenschaftlichen Gemeinschaft insgesamt zugutekommen.
Wie sehen Sie die Kommunikation mit einer breiteren interessierten Öffentlichkeit?
AP: Die Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit macht Open-Science-Praktiken noch wichtiger. Viele Nichtfachleute konzentrieren sich auf die Ergebnisse, ohne sich unbedingt mit den methodischen Details auseinanderzusetzen oder die Robustheit der Ergebnisse zu hinterfragen. Deshalb ist es für Forscher:innen entscheidend, transparente und strenge Praktiken zu befolgen – wie Präregistrierung, Datenaustausch und vollständige Berichterstattung –, um sicherzustellen, dass die von uns kommunizierten Erkenntnisse unvoreingenommen und vertrauenswürdig sind. Open Science verbessert nicht nur die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit innerhalb der Wissenschaft, sondern stärkt auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Forschung, indem es den wissenschaftlichen Prozess zugänglicher und nachvollziehbarer macht.
Vielen Dank!
*Das Interview wurde am 13. August 2025 von Dr. Doreen Siegfried geführt.
** Die Übersetzung des englischen Originalinterviews ins Deutsche erfolgte mit Unterstützung durch DeeplPro.
Über Anna Popova:
Anna Popova ist Doktorandin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo sie sich in ihrer Forschung mit Verhaltensökonomie und Metawissenschaft beschäftigt. Seit Oktober 2024 vertritt sie als PhD Women Representative die Pre-Docs im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Für ihr Masterstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München erhielt sie ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Außerdem ist sie Mitglied von Lab2.
Kontakt: https://www.econ.lmu.de/de/personen/kontaktseite/anna-popova-7b7a998c.html
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/popovaanna/