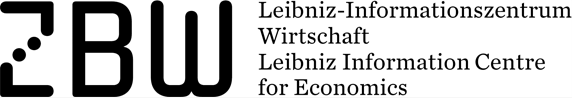„Knowledge-Transfer sollte Teil des Forschungsprozesses sein“
Jörn Redler über seine Open-Science-Erfahrungen

Die drei Key Learnings:
- In Begutachtungsverfahren betriebswirtschaftlicher Forschung sollte neben theoretischer Qualität auch die praktische Relevanz zählen. Jede Publikation sollte idealerweise einen verbindlichen Transferteil enthalten, der Ergebnisse für die Praxis verständlich übersetzt und im Reviewprozess mitbewertet wird.
- Durch offenen Datenaustausch, transparente Methoden und verständlich aufbereitete Ergebnisse wird betriebswirtschaftliche Forschung zugänglicher für Praktiker:innen aus Wirtschaftsunternehmen. So entsteht mehr Austausch und die Chance, dass wissenschaftliche Erkenntnisse tatsächlich in die Praxis einfließen.
- Open Science wirkt wie ein Katalysator: Sie zwingt die BWL und speziell die Marketingforschung, ihre Rolle neu zu reflektieren, gesellschaftliche Relevanz stärker in den Blick zu nehmen und die Theorie-Praxis-Lücke systematisch anzugehen.
Ich möchte mit Ihnen über das sogenannte Theorie-Praxis-Gap in der Marketingforschung und Open Science sprechen. Worin sehen Sie diese Lücke und warum ist sie für die Marketingforschung relevant?
JR: Marketing versteht sich traditionell als angewandte Wissenschaft und erhebt damit den Anspruch, auch Fragen zu behandeln, die für die Praxis relevant sind und deren Ergebnisse in Unternehmen tatsächlich genutzt werden können. Unsere eigenen metawissenschaftlichen Untersuchungen, unter anderem gemeinsam mit dem Kollegen Holger J. Schmidt, haben jedoch gezeigt, dass Forschung und Praxis heute weitgehend entkoppelt sind. Forschungsthemen werden häufig unabhängig von den Problemen der Praxis formuliert, Managerinnen und Manager empfinden die Fragestellungen daher oft als nicht relevant oder bereits gelöst. Hinzu kommt, dass Forschende und Praktiker:innen auf unterschiedliche Evidenzen, Methoden und Begrifflichkeiten zurückgreifen, wodurch Kommunikation und Transfer erschwert werden. Die Folge ist, dass Ergebnisse aus der Marketingforschung die Praxis nur selten erreichen, während Rückmeldungen aus der Praxis kaum in die Forschung einfließen. Dieses Theorie-Praxis-Problem wird zunehmend auch im Zusammenhang mit Open-Science-Initiativen diskutiert. Open Science will Forschung transparenter, nachvollziehbarer und zugänglicher machen. In der Marketingforschung könnte dies helfen, die Distanz zwischen Wissenschaft und Praxis zu verringern – etwa durch offene Daten, reproduzierbare Methoden und frei verfügbare Ergebnisse. Damit ließe sich die Anschlussfähigkeit an die Praxis stärken und möglicherweise ein Teil der bestehenden Lücke schließen.
Würden Sie sagen, die Theorie-Praxis-Lücke ist ein strukturelles Phänomen, also gewissermaßen in der Logik von Wissenschaft angelegt, die rückblickend analysiert, oder handelt es sich eher um ein Missverständnis darüber, welche Themen für die Praxis tatsächlich relevant sind?
JR: Es ist kein grundsätzliches Problem, wenn Forschung Themen behandelt, die erst in der Zukunft relevant werden. Praktiker:innen verstehen die Notwendigkeit solcher vorausschauenden Analysen oder Konzepte. Schwieriger ist vielmehr, dass die Praxis kaum noch Erwartungen an die Wissenschaft richtet. Forschende gelten im Marketing zunehmend nicht mehr als relevante Ansprechpersonen, was weniger an der zeitlichen Perspektive liegt, sondern an einer fehlenden Anschlussfähigkeit der Forschung.
Gibt es typische Situationen, in denen Wissenschaft und Praxis aufeinandertreffen, etwa auf Tagungen? Oder handelt es sich eher um zwei getrennte Welten ohne wirkliche Übergänge?
JR: Es sind eher zwei Inseln. Ein echter Austausch findet kaum statt, obwohl gerade eine stärkere Offenheit auf beiden Seiten wünschenswert wäre. Es liegt aber auch nicht allein an der Wissenschaft; auch die Praxis müsste aktiver den Kontakt suchen. Dennoch ist die Distanz nicht nur das Ergebnis einzelner Fehlentwicklungen, sondern strukturell bedingt. Die Logiken unterscheiden sich: Praxis orientiert sich an schnellen, pragmatischen Lösungen, während Wissenschaft andere Ziele verfolgt und Anreizsysteme etabliert hat, die den Abstand noch vergrößern. Ansätze für Veränderungen müssten daher auch an diesen Strukturen ansetzen.
Sie kennen auch den Arbeitsalltag in der Praxis von Unternehmen. Gibt es typische Situationen, in denen Managerinnen und Manager tatsächlich auf Forschung zurückgreifen würden, etwa wenn neue Strategien oder Konzepte entwickelt werden?
JR: Grundsätzlich müsste es den Anspruch geben, sich für solche Fragen Zeit zu nehmen. In anderen Bereichen ist das selbstverständlich. In der Medizin etwa gehört die Auseinandersetzung mit aktueller Forschung zur kontinuierlichen Weiterbildung. Im Management ist das kaum der Fall. Dort verlässt man sich eher auf Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, eine kurze Internetsuche oder inzwischen auch auf KI-Systeme. Dass jemand gezielt in die wissenschaftliche Literatur schaut oder Kontextualisierungen durch Gespräche mit Wissenschaftler:innen nutzt, haben wir kaum beobachtet. Das hat mehrere Gründe: Zeitdruck, andere Anreizsysteme aber auch die Tatsache, dass wissenschaftliche Artikel in ihrer Form für die Praxis kaum zugänglich sind, zudem oft auch hinter Paywalls verborgen bleiben. Es braucht daher Formate, die Inhalte übersetzen und leichter anschlussfähig machen. Netzwerke oder persönliche Austauschforen könnten hier eine wichtige Rolle spielen, weil sie Diskussionen ermöglichen, ohne dass Forschung als zusätzlicher Ballast empfunden wird. Ohne entsprechende Transferformate bleibt die Distanz zwischen Forschung und Praxis bestehen.
Wenn wir die Wissenschaftsseite betrachten: In der Marketingforschung werden, wie Sie sagen, häufig Themen bearbeitet, die für die Praxis wenig relevant erscheinen. Hinzu kommt eine eigene Fachsprache und die langen Publikationsprozesse, die Ergebnisse oft erst Jahre später verfügbar machen. Wo sollte man Ihrer Ansicht nach ansetzen – bei den Themen oder bei der Kommunikation?
JR: Einen einzelnen Hebel gibt es nicht. Relevanz, Sprache und Geschwindigkeit hängen zusammen. Sinnvoll wäre es, wenn Forschungsthemen stärker gemeinsam mit der Praxis entwickelt würden. Dann entstünde von Beginn an ein gemeinsames Verständnis, und Zwischenergebnisse könnten frühzeitig geteilt werden. Gleichzeitig braucht es eine bessere Übersetzungsarbeit – also Formate, die Forschung verständlich aufbereiten und eine gemeinsame Sprache fördern. Nur durch mehr Austausch auf allen Ebenen lässt sich die Theorie-Praxis-Lücke verkleinern.
Angenommen, Sie müssten auf einer VHB-Tagung ein Plädoyer für die stärkere Einbindung von Unternehmensvertreter:innen in den Forschungsprozess halten: Welche Vorteile hätte der intensive Austausch für die Disziplin und für die einzelne Wissenschaftlerin oder den einzelnen Wissenschaftler?
JR: Die Vorteile hängen stark von der Karrierestufe ab. Für etablierte Forschende kann es sehr erfüllend sein, an Themen zu arbeiten, die nicht nur rein wissenschaftlich interessant sind, sondern auch konkrete Wirkung in der Praxis entfalten. Für Nachwuchswissenschaftler:innen ist die Lage dagegen schwieriger. Solange Karrieren fast ausschließlich über Publikationen in hochrangigen Journals bewertet werden, gibt es für sie kaum Anreize, sich stärker in Richtung Praxis zu engagieren. Genau darin liegt das strukturelle Problem: Die derzeitigen Anreizsysteme honorieren theoretische Exzellenz, aber nicht den Transfer.
Die Anreizstrukturen scheinen also so ausgestaltet, dass sich das Theorie-Praxis-Gap kaum schließen lässt. Was müsste sich Ihrer Ansicht nach ändern, damit mehr Relevanz und Austausch entstehen?
JR: Der zentrale Maßstab für eine wissenschaftliche Karriere sind nach wie vor Publikationen in hochrangigen Journals und die Einwerbung von Drittmitteln. Renommee in der Praxis oder ein belastbares Netzwerk außerhalb der Wissenschaft spielen dagegen keine Rolle. Transferpublikationen oder ein Engagement im Austausch mit Unternehmen werden häufig sogar als Nachteil betrachtet, weil sie Zeit und Ressourcen binden, die man auch in ein weiteres „Top-Journal-Paper“ investieren könnte. Um hier gegenzusteuern, müsste man solche Aktivitäten sichtbar machen und gezielt honorieren, sei es durch Anerkennung von Transferpublikationen oder durch die Berücksichtigung von Praxisresonanz bei Berufungen und Evaluationen. In meinen Augen scheint es zudem sinnvoll, in Reviewprozesse systematisch auch Vertreter:innen der Praxis einzubeziehen. So ließe sich frühzeitig prüfen, ob Forschungsfragen tatsächlich Relevanz besitzen und Ergebnisse Anschluss an praktische Fragestellungen finden können.
Interessante Idee.
JR: Ja, Journal-Editors verweisen zwar darauf, dass es schwierig ist, Personen aus der Praxis für Reviewprozesse zu gewinnen. Trotzdem sollte Relevanz ein verbindliches Kriterium werden. Dazu müsste jede Veröffentlichung einen klaren Transferteil enthalten, in dem die Ergebnisse präzise übersetzt und die praktischen Implikationen herausgestellt werden. Dieser Teil dürfte nicht länger eine formale Pflichtübung sein, sondern sollte im Reviewprozess systematisch berücksichtigt werden.
Müsste sich die Marketingforschung nicht stärker als Disziplin verstehen, die gesellschaftlichen Impact hat? Wird das in der Community diskutiert, oder ist das eher Ihre persönliche Beobachtung?
JR: Das ist in der Tat eine große Frage. Mir fällt diese Lücke auf, und auch einigen Kolleg:innen, aber in der Disziplin wird sie insgesamt zu wenig diskutiert. Im Marketing gibt es zudem ein grundlegendes Problem der Selbstverortung: Was genau wollen wir eigentlich sein? Historisch kommt das Fach in Deutschland eher aus einer vertriebsorientierten Tradition. Später hat man den Fokus auf Austauschprozesse und Wertschöpfung gelegt – ein Konzept, das sehr breit und abstrakt blieb. Zwischenzeitlich kamen Themen wie Purpose oder Nachhaltigkeit hinzu, doch auch das führte nicht zu einer klaren inhaltlichen Positionierung. Ich halte es für dringend notwendig, dass wir in der Disziplin intensiver über unsere Rolle sprechen und definieren, wie wir gesellschaftliche Relevanz schaffen können. Nur so lässt sich die Theorie-Praxis-Lücke ernsthaft adressieren.
Welche Rolle kann Open Science dabei spielen, die Theorie-Praxis-Lücke zu schließen? Geht es vor allem um Transparenz in der Publikation oder um Offenheit im gesamten Forschungsprozess?
JR: Ich sehe mehrere Ebenen. Offenheit sollte bereits am Anfang beginnen, indem Forschungsthemen gemeinsam mit Praxispartnern formuliert werden. Und sie sollte am Ende nicht mit der Publikation aufhören. Forschende müssten stärker darauf achten, wie ihre Ergebnisse aufgenommen und eingeordnet werden. Rückkopplungen während des gesamten Prozesses sind entscheidend. In Projekten, die wir mit Praxispartnern durchführen, zeigt sich, wie wertvoll dieser kontinuierliche Austausch ist – für beide Seiten. Hinzu kommt das Potenzial im Bereich Daten: Wenn Unternehmen ihre Informationen teilen oder bündeln würden, entstünde eine enorme Grundlage für neue Forschung. Open Science bedeutet für mich daher weniger eine technische Frage, sondern vor allem soziale Offenheit, also die Bereitschaft, Praktiker:innen systematisch einzubeziehen
Am Ende ist das doch eine Mindset-Frage. Forschende müssten bewusst sagen: Ich betreibe praxisorientierte Forschung, die Unternehmen, ob nun DAX-Konzern oder Mittelstand, in ihrer Arbeit unterstützt und dadurch Relevanz entfaltet.
JR: Genau, zumindest ein Teil der Forschung sollte diesen Anspruch haben und die Relevanz in den Mittelpunkt stellen. Letztlich geht es um eine Sinnfrage: Womit beschäftigen wir uns, und welche Rolle übernehmen wir als Marketing im System Wissenschaft?
Angenommen, Unternehmensvertreter:innen entwickeln gemeinsam mit Forschenden ein komplexes Thema, das sowohl wissenschaftlich interessant ist als auch Publikationspotenzial hat. Wo genau im Forschungsprozess sollte diese Co-Kreation stattfinden?
JR: Idealerweise begleitet die Zusammenarbeit alle Phasen des Projekts, von der Entwicklung der Fragestellung über das Forschungsdesign bis hin zur Interpretation und Kommunikation der Ergebnisse. In der Praxis kann das unterschiedlich aussehen: Unternehmen bringen ihr Erfahrungswissen ein, etwa welche Ansätze sie bereits getestet haben, während die Wissenschaft die Literatur und methodische Expertise beisteuert. Auch bei der Datenerhebung gibt es verschiedene Modelle, von der Nutzung vorhandener Unternehmensdaten über die gemeinsame Erschließung neuer Quellen bis hin zur Anreicherung externer Daten. Entscheidend ist, dass die Auswertung nicht im Elfenbeinturm geschieht, sondern im Dialog. So kann man prüfen, ob die Analysen tatsächlich zur Lösung der gemeinsam formulierten Frage beitragen. Am Ende sollten beide Seiten Verantwortung übernehmen: Forschende, indem sie die Ergebnisse in die Scientific Community tragen, und Unternehmen, indem sie die Erkenntnisse in ihre Praxis weitergeben.
Würden sich Unternehmen überhaupt darauf einlassen, wenn von Beginn an unklar ist, welche Ergebnisse ein Forschungsprojekt am Ende konkret bringt?
JR: Ich wäre da nicht pessimistisch. Viele Unternehmen sind bereit, sich auf Kooperationen einzulassen, wenn deutlich wird, dass Forschung langfristig Nutzen stiftet. Wichtig ist, Vertrauen aufzubauen und die Breite der Praxis einzubeziehen, nicht nur einzelne Pilotpartner. Reallabore oder kleinere Projekte können dabei als Einstieg dienen und später in größere Forschungsfragen münden. So lernen Forschende zugleich die Komplexität unternehmerischer Realität besser kennen und verstehen, warum es nicht reicht, an einzelnen Stellschrauben zu drehen.
Kann Open Science das von Ihnen problematisierte Theorie-Praxis-Gap wirklich schließen? Oder ist es eher ein Instrument, das Symptome abmildert, während die eigentlichen Ursachen tiefer liegen?
JR: Open Science allein wird das Problem nicht lösen. Es kann aber wichtige Beiträge leisten: durch besseren Datenaustausch, transparentere Kommunikation oder neue Formate der Vermittlung. Open Science ersetzt nicht den grundlegenden Wandel, kann aber Impulse setzen.
Welche Akteure könnten dazu beitragen, die Brücke zwischen Forschung und Praxis zu stärken? Sehen Sie hier vor allem die Fachgesellschaften oder eher die Hochschulen in der Verantwortung?
JR: Zunächst stellt sich die Frage, ob der Wille überhaupt vorhanden ist. Viele fühlen sich im bestehenden System gut eingerichtet. Wenn man aber wirklich etwas verändern will, liegt ein zentraler Hebel bei den Hochschulen und bei der Wissenschaftspolitik. Dort werden die Anreizstrukturen gesetzt, an denen sich Institute und Forschende orientieren. Fachgesellschaften können ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, indem sie nicht müde werden, Dialogräume zu schaffen und gezielt Akteure zusammenzubringen, am besten in kleineren, kuratierten Formaten, die Austausch auf Augenhöhe ermöglichen. Und schließlich wären Förderprogramme denkbar, die Kooperationen mit der Praxis explizit voraussetzen und wissenschaftliche Exzellenz mit praktischer Relevanz verbinden.
Zum Abschluss: Wenn Sie drei Gründe nennen müssten, warum Open Science für die BWL – und speziell die Marketingforschung – eine gute Sache ist, welche wären das?
JR: Erstens kann Open Science die individuelle Motivation stärken. Forschende erleben mehr Sinn in ihrer Arbeit, wenn ihre Ergebnisse nicht nur in der Scientific Community, sondern auch in der Praxis Wirkung entfalten. Zweitens leistet offene Wissenschaft einen gesellschaftlichen Beitrag, etwa durch Erkenntnisse, die Unternehmen, Politik und Öffentlichkeit gleichermaßen nutzen können. Und drittens wirkt Open Science wie ein Katalysator für die Disziplin selbst: Sie zwingt uns, grundlegende Fragen neu zu stellen und unser Selbstverständnis als Fach weiterzuentwickeln.
Vielen Dank!
Das Gespräch wurde geführt am 26. September 2025 von Dr. Doreen Siegfried.
Über Prof. Dr. Jörn Redler:
Jörn Redler ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, an der Hochschule Mainz. Er absolvierte eine Ausbildung als Industriekaufmann, studierte Wirtschaftswissenschaften und promovierte an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Point-of-Purchase Communications, Brand Management, Relevanz von Marketingforschung und Reputationsmanagement wissenschaftlicher Organisationen.
Kontakt: https://www.hs-mainz.de/hochschule/persoenliche-seiten/redler-joern-prof-dr/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joern-redler-a6a713208/