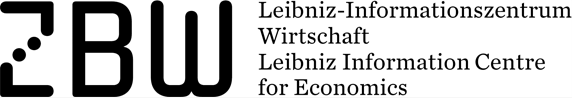„Wer top publizieren will, kommt an Open Science nicht vorbei“
Lukas Fink über seine Open-Science-Erfahrungen
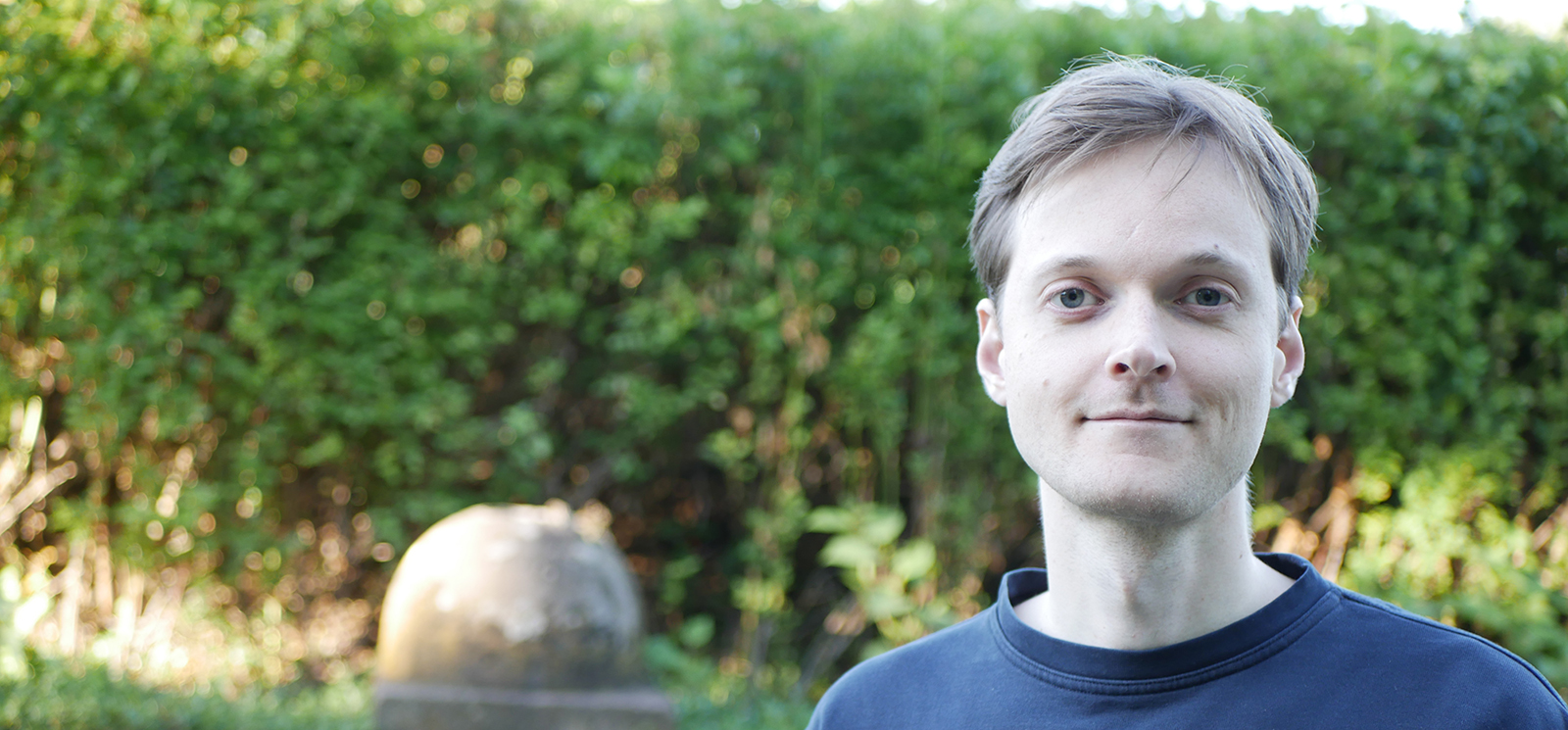
Die drei wesentlichen Learnings:
- Resonanz aus der Community, Feedback von Konferenzen oder direkte Anfragen zu eigenen Daten zeigen, dass die Arbeit relevant ist. Das motiviert und gibt Sinn.
- Reproduzierbares Arbeiten und sauberes Dokumentieren machen Forschung effizienter und sind in Kollaborationen unverzichtbar. Diese Fähigkeiten sind nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Wirtschaft hoch relevant.
- Forschungsdaten und -materialien zu teilen bedeutet nicht nur Transparenz, sondern eröffnet die Möglichkeit für besseres Feedback, Anschlussforschung und neue Kooperationen. Open Science ist damit nicht nur Verpflichtung, sondern auch Chance, wissenschaftliche Arbeit sichtbarer und wirksamer zu machen.
Was bedeutet Open Science für Sie persönlich, und warum ist es gerade in einer frühen Karrierephase wichtig?
LF: Für mich heißt Open Science, den gesamten Forschungsprozess transparent zu gestalten und Ergebnisse offen zu kommunizieren. Das stärkt Vertrauen und erleichtert den Zugang zu Wissen. Ich habe schon während des Masterstudiums gemerkt, welche praktischen Implikationen das hat. In vielen empirischen Seminaren mussten wir zunächst die Ergebnisse eines Referenzpapiers reproduzieren. Ohne Zugang zu Daten oder Code war das nahezu unmöglich. Ganz anders in meiner Masterarbeit, in der ich mich mit einer neuen ökonometrischen Methode beschäftigt habe: Dort habe ich meine Anwendungsbeispiele bewusst auf Studien gestützt, deren Daten und Code öffentlich zugänglich waren. Dadurch konnte ich die bestehenden Analysen besser nachvollziehen, die Ergebnisse leichter verstehen und viel effizienter weiterarbeiten. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wichtig Offenheit für Wissenstransfer ist. Deshalb möchte ich Open Science auch konsequent in meiner eigenen Forschung anwenden.
Als Sie während des Studiums die Aufgabe hatten, bestehende Studien zu reproduzieren: War das ein didaktischer Ansatz der Dozierenden, um Ihnen den Aha-Effekt zu vermitteln, oder haben Sie sich die Arbeiten selbst ausgesucht?
LF: Reproduktionen und Replikationen sind in vielen Seminaren üblich, auch wenn das selten so benannt wird. Meist schlagen die Dozierenden Studien als Referenz vor, die auf bekannten Datensätzen beruhen, weil sich darauf leichter neue Themen entwickeln lassen – etwa mit einer anderen Zielvariable, einem anderen Zeitraum oder einer anderen Methode. Systematisch als „Replikationskurs“ wurde das aber nicht vermittelt, es ist eher eine pragmatische Vorgehensweise. In meiner Masterarbeit habe ich die Auswahl dagegen selbst getroffen und bewusst nur Studien gewählt, die Daten und Code offen zugänglich hatten. So konnte ich die bestehenden Analysen in Detail nachvollziehen, Ergebnisse reproduzieren und anschließend die Robustheit gegenüber der neuen ökonometrischen Methode prüfen. Das war für mich der erste richtige Schritt in die Richtung systematischer Reproduktionen.
Gab es für Sie einen besonderen Moment, der Ihr Interesse an Open Science geweckt hat?
LF: Das Studium war sicher der erste Berührungspunkt. Dort habe ich gemerkt, wie schwierig Reproduktionen ohne Daten und Code sind. Ein weiterer wichtiger Moment war dann die Zusammenarbeit mit meinem Supervisor, Professor Jan Marcus. In einem gemeinsamen Projekt haben wir untersucht, wie häufig Studien, die auf dem Sozio-ökonomischen Panel basieren, Replikationscode bereitstellen. Während dieses Projekts habe ich mich dann auch grundsätzlicher mit Open-Science-Praktiken auseinandergesetzt und verstanden, dass Transparenz und Nachvollziehbarkeit nicht nur mir persönlich helfen, sondern der Forschung insgesamt zugutekommen. Das hat mein Interesse am Thema nachhaltig geprägt.
Wie reagieren Ihre Kolleg:innen auf Ihre Offenheit im Forschungsprozess? Wird Open Science inzwischen als selbstverständlich angesehen?
LF: Die Resonanz ist überwiegend positiv. Zu dem Papier, das ich gemeinsam mit Jan Marcus verfasst habe, gab es viel Interesse – teils auch Überraschung darüber, dass nur etwa sechs Prozent der Studien Replikationsmaterial bereitstellen. Vielen ist klar, dass gerade bei der Verfügbarkeit von Daten und Code Offenheit einen großen Mehrwert bringt.
Bei Präregistrierungen ist die Haltung differenzierter. Manche sehen es als Einschränkung, sich früh auf Analyseverfahren und Datenschritte festlegen zu müssen. Vor allem in der experimentellen Forschung ist Präregistrierung inzwischen weitgehend Standard, während sie in Beobachtungsstudien noch selten praktiziert wird. Zudem gibt es die Sorge, dass Abweichungen im Peer-Review negativ ausgelegt werden könnten.
Welche Rolle spielen Fachgesellschaften wie der Verein für Socialpolitik dabei, Open Science voranzubringen?
LF: Fachgesellschaften sind wichtig, um dem Thema Sichtbarkeit zu geben und eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Tagungen, Workshops und Panels schaffen Räume für Austausch, und über ihre Journals können Fachgesellschaften Standards setzen, indem sie Open-Science-Praktiken nicht nur fördern, sondern auch verbindlich einfordern.
Könnte man sagen: Fachgesellschaften schaffen vor allem Bewusstsein, während Journals letztlich für die Umsetzung sorgen, indem sie konkrete Anforderungen stellen?
LF: Ja, diese Aufgabenteilung beschreibt es ganz gut. Fachgesellschaften können sensibilisieren und Orientierung geben, Journals setzen dann verbindliche Standards. Aber auch die Sensibilisierung allein kann Wirkung zeigen. Das zeigt zum Beispiel eine Studie von Blanco-Perez und Brodeur aus dem Jahr 2020, in der untersucht wurde, wie ein gemeinsamer Aufruf der führenden Health-Economics-Journals, Nullresultate zu berücksichtigen und nicht abzuwerten, dazu beigetragen hat, dass in Health Economics mehr Nullbefunde veröffentlicht wurden. Solche Signale können also messbare Effekte haben – auch ohne sofortige formale Verpflichtungen.
Wenn es um Sensibilisierung geht, kann man zwei Wege unterscheiden: über negative Argumente – etwa Replikationskrisen und alarmierende Befunde – oder über positive Argumente, also die konkreten Vorteile von Open Science für Disziplin und Forschende. Was wirkt aus Ihrer Sicht stärker?
LF: Ein Beispiel ist die Studie der „Open Science Collaboration“ in der Psychologie aus dem Jahr 2015, die zeigte, dass sich viele Experimente nicht erfolgreich reproduzieren ließen. Diese Ergebnisse wurden breit rezipiert, unter anderem auch vom The Economist. Der Begriff „Replication Crisis“ entstand in diesem Kontext und führte dazu, dass viele Psychologie-Journals ab Mitte der 2010er Jahre verbindlichere Data- und Code-Policies eingeführt haben. Unsere eigene Untersuchung zeigt ebenfalls, dass die Verfügbarkeit von Replikationsmaterial seitdem massiv zugenommen hat. Gleichzeitig halte ich es für entscheidend, die positiven Seiten zu betonen. In Gesprächen, gerade mit erfahreneren Kolleg:innen, überzeugt es oft mehr, wenn man aufzeigt, welchen Nutzen Open-Science-Praktiken für die eigene Arbeit haben, etwa strukturierter zu arbeiten und eigene Analysen später – etwa im Revisionsprozess – ohne großen Aufwand nachzuvollziehen und zu reproduzieren. Hinzu kommt, dass man mit offenem Material auch anderen Forschenden hilft, die eigene Arbeit besser zu verstehen. Persönlich bevorzuge ich deshalb, die Vorteile hervorzuheben, statt den Zustand der Wissenschaft als Krise darzustellen.
Was hindert die Disziplin eigentlich daran, schon viel weiter zu sein?
LF: Das frage ich mich auch, aber ich sehe durchaus Bewegung. Immer mehr Journals, nicht nur die Top-Zeitschriften, haben inzwischen verpflichtende Data- und Code-Policies eingeführt. Zusätzlich gibt es neue Rollen wie Data Editors, die nicht nur auf Reproduzierbarkeit von Studien vor Veröffentlichung prüfen, sondern auch Leitfäden, Blogs und Schulungen bereitstellen. Dazu kommen Initiativen wie das Institute for Replication, die Aufklärungsarbeit leisten und Standards verbreiten. In den letzten Jahren hat das Thema dadurch deutlich an Sichtbarkeit und Dynamik gewonnen.
Wie sähe für Sie eine ideale „Open Economics World“ aus – Ihre Wunsch-Arbeitsumgebung für die nächsten Jahre?
LF: In einer idealen Umgebung würden Daten und Code selbstverständlich geteilt, und die Forschenden würden dafür auch Anerkennung erhalten. Praktiken wie Präregistrierungen oder Pre-Analysis-Pläne wären etabliert und würden als Qualitätsmerkmal gesehen. Meine bisherigen Erfahrungen zeigen, dass man dadurch Projekte strukturierter angeht, früh klare Absprachen im Team trifft und insgesamt effizienter arbeitet. Gerade für Nachwuchsforschende ist das enorm wertvoll, da sie insbesondere bei ihren ersten Projekten selten die grundlegende Forschungsidee vorgeben und so frühzeitig in intensive Diskussionen eingebunden werden. Entscheidend wäre, dass dieser Nutzen in der Community stärker verinnerlicht wird und Open-Science-Praktiken auch karriererelevant honoriert werden.
Welche Erfahrungen würden Sie als persönliche Game Changer bezeichnen – Dinge, die Sie gemacht haben und die Sie uneingeschränkt weiterempfehlen würden?
LF: Ein prägendes Erlebnis war, als sich Forschende bei uns meldeten, die unsere Studie zur Verfügbarkeit von Replikationscode gelesen hatten und einen Teil davon selbst nutzen wollten. Wir konnten direkt auf unser vollständiges Replikationspaket verweisen, das wir auf Zenodo hochgeladen hatten. Die Kolleg:innen haben sich bedankt und angekündigt, uns zu zitieren. Das war sehr motivierend. Außerdem bin ich über meine Arbeit zu Open Science auch in eine Kollaboration mit Kolleg:innen vom RWI gekommen. Dort möchten wir zu besonders politikrelevanten Forschungsfragen systematisch Replikationen durchführen. Das zeigt, dass Offenheit nicht nur Transparenz schafft, sondern auch neue Kontakte und Kooperationsmöglichkeiten eröffnet. Darüber hinaus hat sich für mich bewährt, Daten und Arbeitsschritte von Beginn an systematisch zu dokumentieren. Das erleichtert nicht nur die eigene Arbeit, sondern auch die Nachnutzung durch andere.
Spielt Resonanz aus der Fachcommunity für Sie eine besondere Rolle – gerade als Nachwuchswissenschaftler?
LF: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein gutes Gefühl, wenn die eigene Arbeit wahrgenommen und ernst genommen wird. Ein Beispiel war die Anfrage zu unseren Daten, die gezeigt hat, dass sich jemand wirklich mit unserer Forschung auseinandersetzt. Auch die positive Resonanz auf unser Paper, etwa durch die Verbreitung über Bluesky, hat motiviert. Ebenso das Feedback auf Konferenzen: Gerade wenn man ein noch wenig etabliertes Forschungsfeld hat, ist es bestärkend zu hören, dass die eigenen Beiträge als relevant und wichtig eingeschätzt werden.
Stellen wir uns vor, bei der Jahrestagung in Köln trifft Sie jemand, der sagt: „Ich habe keinen Supervisor wie Jan Marcus, möchte aber in Open Science einsteigen.“ Was würden Sie raten – Peer to Peer?
LF: Mein Rat wäre, früh das Gespräch mit dem Supervisor zu suchen und offen über geplante Open-Science-Praktiken zu sprechen. In den meisten Fällen gibt es keinen ernsthaften Widerstand, gerade wenn es um die Veröffentlichung von Code und Daten geht. Oft sind es ohnehin die Nachwuchsforschenden, die den Code schreiben und damit auch für dessen Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit sorgen können. Wichtig ist, die Vorteile zu betonen: Wenn man etwa von Anfang an auf ein Replikationspaket hinarbeitet, das zum Teilen bestimmt ist, erleichtert man in aller Regel auch die Zusammenarbeit im Team.
Und was würden Sie Skeptiker:innen entgegnen? Was sind Ihre drei stärksten Argumente für Open Science?
LF: Mein erstes und stärkstes Argument wäre: Top-Journals verlangen heute in vielen Fällen Replikationspakete oder auch Präregistrierungen von Experimenten. Wer in diesen Zeitschriften publizieren will, kommt an Open-Science-Praktiken kaum vorbei. Zweitens: Reproduzierbarer Code verbessert den eigenen Workflow. Man arbeitet strukturierter, kann Ergebnisse leichter nachvollziehen und ist auch in Kollaborationen effizienter. Diese Fähigkeiten sind nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Privatwirtschaft von großem Wert. Drittens: Offene Wissenschaft ist ein öffentliches Gut. Indem wir Daten, Code und Methoden transparent machen, stärken wir das Vertrauen in die Forschung – innerhalb der Scientific Community und in der Gesellschaft insgesamt. Wenn wir Einfluss haben wollen auf die Gesellschaft, brauchen wir deren Vertrauen. Dieser Anspruch darf nicht abhanden kommen.
Sehr schön, das bringt es auf den Punkt: Future Skills. Ihre ersten beiden Argumente zeigen, wie wichtig es ist, in die eigenen Fähigkeiten und in gutes Kollaborationspotenzial zu investieren, um ein starker Partner in der Forschung zu sein. Ein guter Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch wurde geführt am 8. September 2025 von Dr. Doreen Siegfried.
Über Lukas Fink:
Lukas Fink ist seit April 2023 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für angewandte Statistik an der FU Berlin tätig. Seinen Masterabschluss in Public Economics absolvierte er 2023 an der FU Berlin. Zuvor erlangte er 2020 seinen Bachelorabschluss in Volkswirtschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen. Seine Forschungsinteressen liegen insbesondere in den Bereichen Economics of Science, Public Economics sowie in Fragen der Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit.
Kontakt: lukasfink.eu
Bluesky: @lukasfink.bsky.social
GitHub: https://github.com/Finkovicius
ORCiD: https://orcid.org/0009-0002-8786-0988