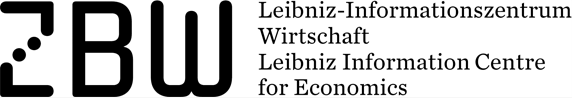Open Science ist eine Haltung für verantwortliche und zukunftsorientierte Wissenschaft
Sebastian Berger über seine Open-Science-Erfahrungen

Foto: Picture People Köln
Die drei wesentlichen Learnings:
- Präregistrierung hilft dabei, analytische Entscheidungen im Vorfeld zu reflektieren. Wichtig ist, eine Präregistrierung als Werkzeug zur Qualitätssteigerung zu verstehen, nicht als formale Pflicht.
- Offen zugängliche Daten und Analysecode schaffen Sichtbarkeit und entlasten langfristig. Konsequentes Teilen kann helfen, an Reichweite zu gewinnen und internationale Kollaborationen aufzubauen. Gute Dokumentation erleichtert zudem nicht nur die externe Nachnutzung – sie reduziert auch Rückfragen und interne Suchkosten. Gleichzeitig signalisiert sie methodische Sorgfalt.
- Open Science ist nicht nur methodisch, sondern auch strategisch relevant. Open-Science-Praktiken können zu besseren Reviews führen, das Vertrauen in Ergebnisse stärken und die Anschlussfähigkeit für interdisziplinäre Kooperationen verbessern. Wer Open Science als Haltung lebt und nicht nur als Formalie erfüllt, positioniert sich aktiv in einem Feld, das sich gerade rasant professionalisiert.
Wie sind Sie erstmals mit dem Thema Open Science in Berührung gekommen? Wann und in welchem Kontext wurden Sie dafür sensibilisiert?
SB: In meiner Promotionszeit zwischen 2008 und 2010 an der Universität zu Köln war Open Science für mich noch kein Thema. Am Lehrstuhl, an dem ich gearbeitet habe, wurden weder Poweranalysen noch Präregistrierung oder andere Praktiken im Sinne von Open Science diskutiert. Allerdings war ich dort in ein DFG-Projekt eingebunden, das sich mit der Robustheit psychologischer Forschung befasst hat – konkret im Bereich Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik. Interessanterweise waren das auch die Felder, die von der Replikationskrise zunächst vergleichsweise wenig betroffen waren, da dort häufig repliziert wurde und es sich oft um korrelative Forschung handelte.
Erstmals direkt mit den Problemen mangelnder Replizierbarkeit kam ich dann als Postdoc in Berührung, als ich an ein Institut mit Schwerpunkt Social Cognition wechselte. Dort wurde intensiv zu Priming-Effekten geforscht. Und genau in diesem Zusammenhang traten die bekannten Probleme rund um „false positives“ besonders deutlich zutage. In dieser Phase stieß ich auf die ersten Veröffentlichungen von Joe Simmons, Leif Nelson und Uri Simonsohn – also die Gruppe, die später auch den Blog Data Colada ins Leben gerufen hat. Diese Arbeiten haben mir erstmals die systematischen Schwächen in der damaligen Forschungspraxis bewusst gemacht.
Das war für mich ein Wendepunkt. Ich begann, die gängige Priming-Forschung zunehmend kritisch zu hinterfragen und mich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Ergebnisse wir überhaupt publizieren sollten. Parallel dazu entstanden erste Initiativen wie das Open Science Framework (OSF), insbesondere rund um die Gruppe um Brian Nosek. Ich würde sagen, ich war dann relativ früh dabei – im Sinne eines „Early Adopters“. Als Postdoc hatte ich erstmals die Freiheit, eigenständig zu arbeiten, und habe die Prinzipien von Open Science umgesetzt, sobald das praktisch möglich war.
Wenn Sie sagen „Early Adopter“ – meinen Sie damit die Nutzung des Open Science Frameworks (OSF) oder etwas anderes?
SB: Teils, teils. Zunächst haben wir vor allem AsPredicted genutzt, das OSF kam erst später in unserer Arbeit zum Einsatz. Entscheidend war, dass wir früh begonnen haben, solche Tools zu nutzen und damit eine andere Forschungskultur zu etablieren. Als ich 2013 als Postdoc an das Institut von Axel Ockenfels kam, habe ich einen deutlichen Kulturunterschied wahrgenommen. Zwar wurde dort nicht explizit von Open Science gesprochen, aber viele Prinzipien waren bereits implementiert – etwa, dass alle Hypothesen vorab klar formuliert sein mussten, dass Daten und Analysen vollständig vorbereitet und intern auf Servern dokumentiert wurden. Diese Standards waren institutsintern bereits fest verankert.
Die formale Präregistrierung über externe Plattformen – also die öffentliche Dokumentation von Studien vor der Datenerhebung – kam dann etwas später hinzu. Ich würde sagen, das begann bei uns etwa zwischen 2012 und 2015. Seitdem haben wir das systematisch umgesetzt: Konfirmatorische Experimente werden präregistriert, meist über AsPredicted, und alle Daten sowie der Analysecode werden offen zugänglich gemacht. In unseren Papieren verweisen wir dann auf die entsprechenden Repositorien, damit alle Informationen vollständig nachvollziehbar sind.
Sie sprachen von einem Kulturwandel – zunächst wurden Daten intern gespeichert, später dann über das OSF öffentlich zugänglich gemacht. Wie genau haben Sie diesen Wandel erlebt? Was hat sich für Sie konkret verändert?
SB: Der entscheidende Unterschied war für mich, dass ich mit dem Wechsel in die Rolle als Assistenzprofessor zunehmend selbst Entscheidungen treffen konnte. Das bedeutete auch, dass ich klare Erwartungen formulieren konnte: Wer mit mir zusammenarbeiten wollte, musste bereit sein, mit dem OSF zu arbeiten und die Prinzipien von Open Science mitzutragen. Ich habe das zur Voraussetzung für Kooperationen gemacht – und in einigen Fällen hieß das auch, bestimmte Kollaborationen nicht weiterzuführen. Gerade in Bereichen wie Social Cognition oder Consumer Research, in denen ich zuvor aktiv war, habe ich erlebt, dass die Bereitschaft zur Anpassung an Open-Science-Praktiken zunächst eher gering war. Das hat zu Spannungen geführt, aber für mich war klar: Ich möchte nur noch in Projekten arbeiten, die diese Standards ernst nehmen und umsetzen.
Und wie haben potenzielle Kooperationspartner reagiert, wenn Sie klar signalisiert haben, dass eine Zusammenarbeit nur unter den Bedingungen von Open Science stattfindet?
SB: Ich habe das in der Regel nicht konfrontativ kommuniziert. Meist lief es eher so, dass ich sagte: „Ich würde das gerne noch präregistrieren“ oder „Ich möchte den Analysecode offenlegen“. Dadurch haben sich die Prozesse verlängert, etwa bis ein Experiment starten konnte. Oft haben sich die Partner dann einfach nach anderen Kooperationsmöglichkeiten umgesehen. Gerade im Bereich der Konsumentenforschung sind auf diese Weise mehrere Kooperationen im Sande verlaufen. Es war selten ein klarer Abbruch, sondern eher ein schleichender Prozess. Man ist ohnehin mit vielen Projekten beschäftigt, und wenn die Prioritäten nicht mehr übereinstimmen, verlagert sich die Aufmerksamkeit. Ich habe gemerkt, dass ich solchen Projekten zunehmend weniger Gewicht beigemessen und mich inhaltlich neu orientiert habe – hin zu Themen, bei denen Open-Science-Praktiken selbstverständlicher Teil der Zusammenarbeit waren.
Haben Sie den Rückzug potenzieller Kooperationspartner als Nachteil empfunden?
SB: Nein, ich sehe das nicht als Nachteil. Ich habe immer interdisziplinär gearbeitet – mit Kolleg:innen aus VWL, BWL, Psychologie, Neurowissenschaften und sogar aus der Biologie. Dabei wird schnell deutlich, wie unterschiedlich die Forschungspraktiken sind, und dass manche Kooperationen im Sande verlaufen, wenn man bestimmte Standards einfordert. In manchen Disziplinen gibt es dafür nachvollziehbare Gründe. In den Neurowissenschaften etwa ist eine detaillierte Präregistrierung oft schwer umsetzbar, weil viele Analyseentscheidungen erst während der Auswertung getroffen werden können. Die Anzahl an Freiheitsgraden ist hoch, und nicht alle Entscheidungen lassen sich im Vorfeld antizipieren. Eine zu rigide Präregistrierung kann hier realitätsfern sein – und die Zusammenarbeit erschweren oder sogar verhindern.
Ähnliches gilt für Feldexperimente, etwa in Projekten mit Energieversorgern. Wir arbeiten dort beispielsweise mit Smart-Meter-Daten aus Haushalten. Dabei treten immer wieder unvorhergesehene Fälle auf, zum Beispiel Haushalte, die plötzlich mit mehreren Stromzählern arbeiten, weil sie zusätzliche Verbrauchsquellen wie Pools haben. Das kann man nicht antizipieren. Ob solche Fälle in der Analyse berücksichtigt oder ausgeschlossen werden, kann man oft erst im Nachhinein sinnvoll entscheiden. Eine strikte Präregistrierung würde solche Flexibilität nicht zulassen. Insofern gilt: Sehr eng gefasste Präregistrierungen funktionieren gut in kontrollierten Laborsettings, stoßen aber in komplexen, realweltlichen Forschungsdesigns an ihre Grenzen.
Wenn sich während der Feldphase unvorhersehbare Fälle ergeben – etwa Haushalte mit mehreren Stromzählern für Pool oder Sauna – lässt sich das doch im Nachhinein transparent kommunizieren, oder?
SB: Ja, das ist ein berechtigter Punkt. Ich sehe dabei zwei grundsätzliche Haltungen zur Präregistrierung, quasi zwei „Menschenbilder“. Die eine Gruppe geht davon aus, dass Präregistrierung ehrlichen Forscher:innen hilft, bessere Forschung zu machen. Dazu zähle ich mich. Die andere sieht den Menschen als grundsätzlich opportunistisch – mit dem Ergebnis, dass nur strenge Regeln und Kontrollen wissenschaftliches Fehlverhalten verhindern können. Wenn man letzterer Auffassung folgt, sind flexible Präregistrierungen wenig wirksam, weil Freiheitsgrade als Schlupflöcher wahrgenommen werden. Ich persönlich sehe Präregistrierung eher als Werkzeug zur eigenen Reflexion: Sie hilft mir, meine Studien besser zu planen – schon bevor Ressourcen investiert werden. Das verbessert meine Forschung spürbar.
Zudem hat sich Präregistrierung heute in vielen Bereichen als Standard etabliert. Selbst skeptische Kolleg:innen erkennen zunehmend, dass Transparenz zur Glaubwürdigkeit beiträgt. Das hat auch eine reputationsfördernde Wirkung. Gleichzeitig sehe ich die Grenzen solcher Verfahren, etwa im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung, wo viele qualitativ oder explorativ arbeiten. Für diese Kolleg:innen wirken deduktiv-experimentelle Anforderungen wie Präregistrierung oft unpassend. Obwohl auch sie mit guten Absichten forschen, passen sie nicht in das dominante Modell. Daraus ergeben sich reale Herausforderungen im interdisziplinären Austausch.
Mich würde Ihre persönliche Erfahrung interessieren: Sie sagen, Sie stehen hinter Open Science und sind überzeugt, dass wir durch diese Ansätze mehr über die Welt lernen. Welche Reaktionen und welche Vorteile haben Sie selbst erlebt?
SB: Ich habe dabei einen deutlichen Generationenkonflikt erlebt. Jüngere Kolleg:innen gehen mit Open Science ganz selbstverständlich um. Sie sind mit digitalen Tools vertraut, können programmieren, nutzen Repositorien routiniert. Für sie ist das oft Standard. Bei älteren Kolleg:innen, etwa früheren Betreuer:innen oder auch langjährigen Editors, war die Skepsis deutlich größer. Da war häufig mehr Überzeugungsarbeit nötig. Dieses Spannungsfeld zwischen jüngeren, technologieaffinen Forschenden und einer eher zurückhaltenden älteren Generation habe ich in meinem Fach sehr deutlich wahrgenommen – und es ist zum Teil bis heute spürbar.
Haben Sie einen Tipp für Forschende, die an ihrem Lehrstuhl allein mit ihrer Offenheit für Open Science dastehen? Wie kann man Kolleg:innen – auch wenn sie in der Hierarchie höher stehen – konstruktiv ins Boot holen?
SB: Zwei Strategien haben sich bewährt. Erstens: mit guten Beispielen arbeiten. Es gibt inzwischen anerkannte Fachzeitschriften, die Registered Reports veröffentlichen. Auch die American Economic Association unterstützt Trial Registries. Man kann also zeigen: Open Science ist längst im wissenschaftlichen Mainstream angekommen. Zweitens: auf die Motivation der Person eingehen. Wer ehrlich an Erkenntnis interessiert ist, lässt sich eher über inhaltliche Argumente überzeugen, etwa durch Beispiele für Fehlentwicklungen oder gelungene Replikationen. Bei Kolleg:innen, die eher defensiv oder ablehnend reagieren, helfen häufig nur strukturelle Anreize, zum Beispiel institutionelle Vorgaben oder Förderkriterien, die Open-Science-Praktiken einfordern.
Wie gehen Sie konkret in Bern mit Skepsis um?
SB: Was in solchen Fällen hilft, ist, die Kosten für die Kooperation niedrig zu halten. Ich biete konkret an, Aufgaben wie das Hochladen von Code oder Daten zu übernehmen – einfach, um die Einstiegshürde zu senken. Wenn dann im Peer Review positives Feedback zur Transparenz kommt, etwa: “State-of-the-art data handling and code sharing – congratulations”, wirkt das oft überzeugender als jedes Argument im Vorfeld.
Verstanden – das ist ein guter Ansatz.
SB: Genau, solche positiven Rückmeldungen im Peer Review überzeugen viele. Wenn man mehrfach erlebt, dass Manuskripte mit Open-Science-Komponenten besser bewertet oder schneller angenommen werden, verändert das auch die Haltung gegenüber diesen Praktiken. Von Forschenden, die kurz vor dem Ruhestand stehen – sagen wir zwischen 55 und 65 – kann man aber nicht erwarten, dass sie sich noch ein eigenes Open-Science-Profil aufbauen. Das ist verständlich und auch nicht zwingend ihre Aufgabe. Vieles wird ohnehin generationsübergreifend im Team erledigt. Jüngere Kolleg:innen bringen oft das technische Know-how mit, etwa für Plattformen wie GitHub, und übernehmen die praktische Umsetzung. Diese Arbeitsteilung funktioniert gut und ist ein sinnvoller Weg, um Open Science schrittweise im Forschungsalltag zu verankern.
Könnte man sagen, dass neben der interdisziplinären auch eine intergenerationale oder interprofessionelle Zusammenarbeit entsteht – also: die einen bringen als Senior Researcher ihr Erfahrungswissen ein, die anderen als Early Career Researcher ihre Open-Science-Kompetenz, und gemeinsam entsteht ein stimmiges Gesamtprojekt?
SB: Ja, genau – auch wenn das oft nicht ausdrücklich thematisiert wird, funktioniert diese Aufgabenteilung meist gut. Ich habe mit sehr erfahrenen Kolleg:innen zusammengearbeitet, die eher eine beratende Rolle übernehmen, während ich oder jüngere Teammitglieder die Open-Science-Komponenten umsetzen. Das muss man nicht immer explizit festhalten – es ergibt sich oft organisch. Ich sehe mich dabei in einer vermittelnden Rolle: Ich unterstütze die Jüngeren, sich einzuarbeiten, und entlaste die Älteren, indem ich klare Zuständigkeiten setze. Das schafft Akzeptanz ohne Überforderung.
Was raten Sie Promovierenden, die Open Science praktizieren möchten, aber von ihren Betreuer:innen etwas ausgebremst werden?
SB: Wichtig ist, dass man Promovierenden daraus keinen Nachteil macht – etwa in Berufungsverfahren. Viele haben schlicht keine Möglichkeit, Open-Science-Praktiken umzusetzen, obwohl sie es wollen. Das sollte man im Gespräch offen erfragen. Darüber hinaus empfehle ich allen Interessierten, sich unabhängig weiterzubilden. Es gibt lokale Open-Science-Gruppen, Online-Formate, hochwertige YouTube-Kanäle und offene Schulungsangebote, die niedrigschwellig zugänglich sind. Auch wenn man bestimmte Praktiken im eigenen Dissertationsprojekt nicht umsetzen darf, kann man sie im Hintergrund anwenden oder sich methodisch vorbereiten – etwa durch Replikationsprojekte, Nebenprojekte oder eigene Präregistrierungen.
Ein häufiges Gegenargument von Betreuenden lautet: Open Science ist schön und gut, aber der Aufwand ist enorm. Während man Daten hochlädt und Metadaten erstellt, könnte man auch ein weiteres Paper schreiben.
SB: Dieses Argument kennt man auch aus anderen Bereichen – etwa der Laborsicherheit oder Universitätsverwaltung. Ja, Open-Science-Praktiken erhöhen den organisatorischen Aufwand. Aber der wissenschaftliche Konsens ist: Der Nutzen überwiegt die Kosten. Zudem entwickelt sich die Infrastruktur ständig weiter. Tools wie AsPredicted oder automatisierte Repositorien machen viele Prozesse heute deutlich effizienter. Die Community arbeitet aktiv daran, diese Hürden weiter zu senken – durch bessere Tools, automatisierte Abläufe und unterstützende Dienste.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, bei dem Open Science für Sie wirklich etwas verändert hat – etwa neue Kontakte, Kooperationen oder Sichtbarkeit?
SB: Ja, ein Schlüsselmoment war während der Corona-Pandemie. Damals entstand ein internationales Netzwerk aus Kolleg:innen verschiedener Universitäten – Amsterdam, Kopenhagen, Chicago, Bern, Hohenheim, Lüneburg, alle mit einem klaren Bekenntnis zu Open Science. Es war keine offizielle Struktur, sondern eine informelle, aber verbindliche Zusammenarbeit. Jede Kooperation basierte auf Open-Science-Prinzipien – von Präregistrierung bis zur offenen Datenverfügbarkeit. Und das war extrem erfolgreich: bessere Publikationen, mehr Einladungen, Preise, Sichtbarkeit. Bei Early-Career-Auszeichnungen wird heute oft ausdrücklich erwähnt, dass der Einsatz von Open Science mitentscheidend war. In vielen Kontexten ist es inzwischen fast selbstverständlich – oder zumindest klar von Vorteil.
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wie Sie Open Science in dieser Zusammenarbeit praktisch umsetzen – und was sich daraus ergeben hat?
SB: Ein zentrales Element ist das konsequente Teilen, sei es von Vorträgen, Daten, Code, Methoden oder auch einfach von Erfahrungen. Während der Pandemie haben wir begonnen, Vorträge online zu stellen. Das hat Reichweite geschaffen, die es vorher nicht gab. Plötzlich konnten Menschen weltweit teilnehmen, ohne reisen zu müssen – das hat auch für mich persönlich vieles verändert. Das Prinzip „Teilen“ hat auch eine große Wirkung auf die Sichtbarkeit bei jüngeren Forschenden. Seit wir systematisch Codebooks, Programmierlösungen oder methodische Hinweise veröffentlichen – manchmal sogar Career-Tipps, entsteht eine stärkere Bindung. Bei einem Treffen in Amsterdam kam ein ganzer Doktorand:innenkreis auf mich zu, weil sie meine Arbeit aus dem Netz kannten. Zwanzig Doktorand:innen aus Amsterdam kennen Sebastian Berger! Das hätte es früher so nicht gegeben. Daraus ergeben sich konkrete Folgeeffekte: Man kennt sich, tauscht sich aus, vermittelt Doktorand:innen zwischen den Standorten. Ich kann heute sagen: „Geht nach Kopenhagen, Chicago oder Amsterdam – da gibt es gute Leute.“ Vielleicht ist das eine gewisse Bubble, ja – aber sie hat reale Effekte. Und nicht zuletzt: Wenn ich meinen Code veröffentliche, prüfe ich ihn natürlich noch einmal sorgfältiger. Auch das verbessert die Qualität der Forschung.
Was Sie gerade sagen, erinnert mich an ein Gespräch mit Michael Soliman von der Universität Lüneburg. Er beschäftigt sich mit Glücksforschung und meinte, viele Prinzipien daraus passen gut zu Open Science. Sein Punkt war: Für stabile soziale Bindungen braucht es Ehrlichkeit und auch Verletzlichkeit – man muss bereit sein, sich unvollkommen zu zeigen. Und genau das sehe ich bei Open Science auch: Wer frühzeitig teilt – etwa unfertige Analysen oder offenen Code – macht sich angreifbar, schafft aber gleichzeitig Nähe und Vertrauen. Würden Sie dem zustimmen?
SB: Absolut. Ich hatte neulich ein langes Gespräch mit einer Nachwuchskollegin, die sehr talentiert ist, aber große Sorgen hatte, Fehler könnten auffallen, wenn sie ihre Arbeit offenlegt. Ich habe ihr gesagt: Ehrliche Fehler sind kein Problem – im Gegenteil. Die Menschen, die man in der Wissenschaft wirklich ernst nimmt, verzeihen das, solange man offen damit umgeht. Wenn jemand in deinem Code einen Fehler findet, sagst du: „Danke, dass du es gesehen hast – wir ändern das.“ Natürlich ist das manchmal unangenehm, besonders wenn viele Ko-Autor:innen beteiligt sind. Aber genau das verbessert die Forschung. Open Science bedeutet, die eigene Arbeit zur echten Prüfung freizugeben – nicht nur durch Reviewer, sondern durch die ganze Community. Früher war die Haltung oft eine andere: Wenn der Reviewer den Fehler nicht bemerkt, bleibt er eben drin. Das war eine gewisse „Spielkultur“, in der es eher darum ging, durchzukommen. Und genau das sollte sich ändern.
Auf jeden Fall.
SB: Heute gibt es Formate wie Go Check My Code oder Please Replicate Me, bei denen man aktiv dazu einlädt, den eigenen Code zu prüfen oder eine Replikation durchzuführen. Diese Offenheit ist inzwischen Teil der Praxis geworden. Was mir dabei auch auffällt – gerade zum Thema Sichtbarkeit: Ich bekomme inzwischen regelmäßig Anfragen für Metastudien. Früher war das eine Katastrophe. So eine E-Mail bedeutete oft einen Tag Arbeit: Erst musste ich das alte Paper finden, dann die richtigen Daten, feststellen, ob sie überhaupt noch zugänglich sind, ob es ein Codebook gibt – meist war nichts gut dokumentiert. Heute ist das anders. Letzte Woche, am Pfingstmontag, bekam ich eine Anfrage aus Österreich – während ich gerade von einer Wanderung zurückkam. Ich konnte direkt vom Handy aus antworten: „Hier ist der Link, alle Daten und der Code sind online.“ Das war’s. Das ist nicht nur effizienter, sondern auch entlastend. Ich muss keine Dateien mehr zusammensuchen oder erklären, was die Variablen bedeuten. Alles steht im Codebook, das online verfügbar ist. Die Verantwortung liegt dann bei der anfragenden Person – und ich habe den Kopf frei für andere Dinge.
Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Big Team Science gemacht?
SB: Ich war bereits an mehreren Projekten beteiligt, einige davon sind auch schon veröffentlicht. Aktuell arbeite ich an mehreren großen Vorhaben mit – und meine Erfahrungen damit sind durchweg positiv. Big Team Science ist eine sehr erfüllende Form der Zusammenarbeit, weil man weiß, dass man Teil eines größeren, gut koordinierten Prozesses ist. Ich war in unterschiedlichen Rollen involviert: als Core-Team-Mitglied, als Unterstützer, als Analyst oder Co-Analyst und auch in der Datenerhebung – etwa als Koordinator für ein Land in einem internationalen Projekt mit über 70 Ländern. Unabhängig von der Rolle: Die Zusammenarbeit ist bereichernd, methodisch anspruchsvoll und fachlich sehr produktiv.
Wie funktionieren die verschiedenen Rollen in Big-Team-Science-Projekten?
SB: Big Team Science ist ein kooperativer Forschungsansatz, bei dem viele Teams gemeinsam an einer übergeordneten Fragestellung arbeiten. Ziel ist es, Ressourcen, Daten und methodische Expertise zu bündeln – etwa für internationale Studien oder komplexe Designs mit mehreren Interventionen. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Ein zentrales Core Team übernimmt Planung und Steuerung, während andere Teams – zum Beispiel sogenannte Country Teams – für Aufgaben wie Datenerhebung, Übersetzung oder lokale Anpassungen zuständig sind. In Multi-Analyst-Projekten analysieren viele Teams denselben Datensatz, um methodische Variation und Ergebnisrobustheit sichtbar zu machen.
Jedes Team leistet einen Teilbeitrag zum Gesamtprojekt, ohne die gesamte Studie allein stemmen zu müssen. Das fördert nicht nur Effizienz und Qualität, sondern auch Vernetzung, Sichtbarkeit und ein starkes Gefühl wissenschaftlicher Gemeinschaft. Man fühlt sich tatsächlich als Teil eines Teams, und das ist sehr motivierend. Und man hat das Gefühl, an einer relevanten Fragestellung mitzuwirken. Wenn beispielsweise rund 200 Forschende aus dem eigenen Fachgebiet beteiligt sind, und das Feld selbst gar nicht so groß ist, entsteht das Gefühl, einen echten Beitrag zu leisten. Das wird auch spürbar, wenn man später auf Konferenzen ist: Plötzlich ist man durch gemeinsame Publikationen mit vielen Kolleg:innen verbunden. Man wird als Teil der Community wahrgenommen. Die Aspekte, die Sie vorhin aus der Glücksforschung angesprochen haben – etwa das Gefühl von Zugehörigkeit durch Offenheit und Kooperation – finden sich hier ganz konkret wieder.
Das kann ich mir gut vorstellen.
SB: Ein weiterer Vorteil ist, dass man tiefe Einblicke in unterschiedliche Forschungsteams bekommt – besonders, wenn man selbst eine koordinierende oder leitende Rolle übernimmt. Solche Projekte folgen meist einem ähnlichen Aufbau: Eine verantwortliche Person, häufig ein Postdoc, übernimmt die Gesamtkoordination und fungiert als Erstautor:in. Ein erfahrener Senior Researcher steht als Letztautor:in im Projekt. Dazwischen gibt es ein sogenanntes Core Team, meist bestehend aus fünf bis zehn Personen, das die wissenschaftliche Ausrichtung und operative Umsetzung maßgeblich mitgestaltet. Daneben stehen die Country Teams, die in den jeweiligen Ländern für Datenerhebung, Übersetzung oder Kontextanpassung zuständig sind.
Das heißt, das Team legt gemeinsam das Forschungsdesign fest?
SB: Genau. Und es geht noch darüber hinaus – auch das Projektmanagement ist hochstrukturiert. Ich arbeite aktuell am Heat Cognition Project, einem internationalen Forschungsverbund. Alle Rollen, Zuständigkeiten und Prozesse sind dort detailliert dokumentiert. Das Dokument ist rund 20 Seiten lang. Es beschreibt, wer welche Aufgaben übernimmt, wie präregistriert wird, wo die Daten gespeichert werden, welche Publikationen geplant sind, welche Rechte und Pflichten die Mitwirkenden haben und wie die Zusammenarbeit gestaltet wird. Das schafft eine hohe Transparenz und man lernt enorm viel, auch im Hinblick auf internationale Kooperationen. Inhaltlich untersuchen wir im Projekt, wie sich Hitzewellen auf menschliches Verhalten und psychische Prozesse auswirken – ein Thema, zu dem es bisher nur begrenzt systematische Forschung gibt. Ursprünglich wollten wir das in kleinerem Rahmen hier in Bern untersuchen, mit einem Doktoranden. Jetzt wird das dieselbe Studie parallel in Städten wie Bern, Dhaka, Nairobi, New York und Lima durchgeführt. Das macht das Projekt nicht nur wissenschaftlich relevanter, sondern auch attraktiver für die Publikation. Die Reichweite ist größer, die Zitationswahrscheinlichkeit steigt – und gleichzeitig ist der Erkenntnisgewinn viel breiter, als wenn jeder für sich eine einzelne Studie an seinem Standort durchführt.
Es gibt doch auch den Ansatz, bei dem alle Teams dieselbe Fragestellung und denselben Datensatz bekommen, aber die Methoden jeweils selbst wählen. Dabei schaut man dann, ob und wie stark sich die Ergebnisse unterscheiden.
SB: Genau, solche Projekte gibt es – und ich bin aktuell an einem beteiligt, das gerade zur Revision bei Nature eingereicht wird. Das Konzept dahinter ist hochspannend: Man nimmt ein publiziertes Ergebnis, also einen bestehenden Befund, und lässt viele Teams denselben Datensatz analysieren, allerdings mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen. Die Grundidee ist, dass kluge und gut ausgebildete Forschende zwar alle methodisch sauber arbeiten, aber dennoch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können – je nachdem, welche Analyseentscheidungen sie treffen. In unserem Projekt geht es um eine systematische Erhebung solcher Variabilität: Wie robust sind veröffentlichte Effekte tatsächlich? Und wie groß ist die Spannbreite an Analysewegen, selbst unter Expert:innen? Diese sogenannten Many-Analyst-Studienmachen sichtbar, dass methodische Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen – und dass unterschiedliche Herangehensweisen zu teils deutlich unterschiedlichen Resultaten führen können.
Eine praktische Frage: Wenn eine Doktorandin sagt: „Big Team Science klingt spannend, ich möchte da mitmachen“. Wie kommt man an solche Projekte heran? Gibt es Plattformen, auf denen man sich bewerben kann?
SB: Solche Projekte werden meist öffentlich ausgeschrieben – vor allem über X oder über E-Mail-Verteiler von Fachkonferenzen. Manchmal läuft es aber auch informeller: Wer bereits involviert ist, gibt entsprechende Hinweise direkt im eigenen Umfeld weiter, zum Beispiel an Doktorand:innen oder Kolleg:innen.
Wenn ich also nichts über Social Media oder auf Tagungen mitbekomme, wäre es eine Option, einfach Autor:innen bestehender Big-Team-Science-Publikationen anzuschreiben und Interesse zu bekunden?
SB: Absolut. Das funktioniert gut – und das Interesse an solchen Projekten ist enorm. In einem unserer letzten Vorhaben, bei dem es um Vertrauen in Wissenschaft und wissenschaftsbezogenen Populismus ging [Trust in scientists and their role in society across 68 countries], hatten wir innerhalb weniger Tage rund 500 Anfragen zur Beteiligung.
Eine abschließende Frage: Wo sehen Sie das Thema Open Science in Zukunft?
SB: Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren deutlich weniger explizit über Open Science sprechen werden, weil es sich zunehmend als Standard etabliert. Viele Praktiken, die heute noch diskutiert werden, werden einfach vorausgesetzt sein. Das zeigt sich auf mehreren Ebenen. Als ich angefangen habe, haben wir beispielsweise noch überwiegend mit Stata gearbeitet – heute ist R in vielen Bereichen Standard, auch weil es Open Source ist und die Offenheit in der Analyse erleichtert. In der psychologischen Ausbildung wird zum Beispiel kaum noch mit SPSS gearbeitet – das zeigt, wie sich methodische Standards verschieben. Meine Prognose ist: Open Science wird ähnlich selbstverständlich wie etwa das Publizieren auf Englisch – was im deutschsprachigen Raum ja auch kaum noch infrage gestellt wird.
Vielen Dank!
*Das Gespräch wurde geführt am 16. Juni 2025 von Dr. Doreen Siegfried.
Über Dr. Sebastian Berger:
Dr. Sebastian Berger ist Dozent am Institut Sustainable Business der Berner Fachhochschule. In seiner Forschung verbindet er Ansätze aus Psychologie, Soziologie, Ökonomie und Umweltwissenschaften, um zu untersuchen, welche Faktoren individuelles und kollektives Verhalten im Kontext nachhaltiger Entwicklung beeinflussen. Seine Arbeiten erscheinen in interdisziplinären Fachzeitschriften wie Nature Climate Change, Nature Human Behaviour, Science Advances, Global Environmental Change oder dem Journal of Economic Behavior & Organization.
Zuvor war Berger Assistenzprofessor an der Universität Bern, Postdoc in der Soziologie an der Stanford University, in der Ökonomie an der Universität Lausanne sowie in der Sozialpsychologie an der Universität zu Köln tätig – gefördert durch die DFG und den Schweizerischen Nationalfonds. Er hat ein Diplom in Volkswirtschaftslehre (2008) und wurde 2010 mit einer Arbeit an der Schnittstelle von Sozial- und Wirtschaftspsychologie promoviert.
Kontakt: https://www.bfh.ch/de/forschung/forschungsbereiche/sustainable-business/ueber-uns/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebastian-berger-80a526203/
OSF: https://osf.io/r3vde/